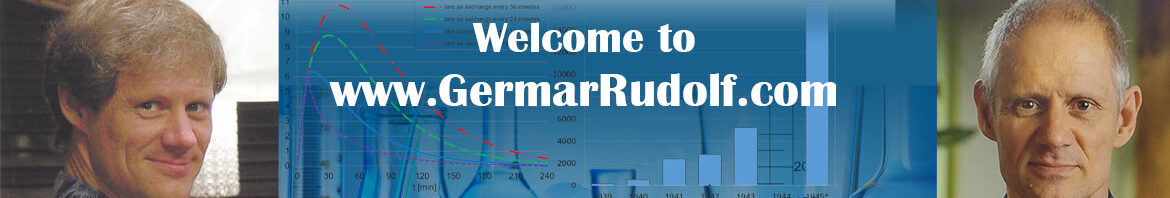Eine Welt bricht zusammen
Herbst 1999. Seit etwa dreieinhalb Jahren lebe ich nun im englischen Exil. Der 29. Oktober ist mein Geburtstag. Das ständig über mir schwebende Damoklesschwert einer drohenden britischen Auslieferung an Deutschland hat meine Frau zermürbt. Im Januar 1999 ist sie daher mit unseren zwei Kindern nach Deutschland zurückgekehrt, wohin ich ihr nicht folgen kann. Sie hat die ständige Angst um die Zukunft ihrer Kinder und unseren von allerlei Vorsichtsmaßnahmen geprägten Lebensstil nicht mehr ausgehalten. Sie hatte öfters Alpträume und war zunehmend nervös. Im März 1999 teilte sie mir dann mit, daß sie sich von mir scheiden lassen wolle, eine für mich völlig unerwartete Entscheidung, weil wir ursprünglich vereinbart hatten, es in ein paar Jahren noch einmal miteinander zu versuchen, wenn sich herausgestellt hat, daß England nichts gegen mich unternehmen würde. Somit droht mein 35. Geburtstag zugleich mein deprimierendster zu werden, den ich je hatte, da ich ihn das erste Mal seit sieben Jahren ohne meine geliebte Frau und meine süßen Kinder würde verbringen müssen. Aber Kopf hoch, immerhin hat meine Frau mir versprochen, sie würde mich mit den Kindern zu meinem Geburtstag besuchen. Und auch meine Geschwister haben angekündigt, eine Woche darauf bei mir reinzuschneien. Ganz so schlecht sieht es also gar nicht aus.
Es ist Freitag, der 15. Oktober 1999. Ich erledige meine übliche Arbeit. Während der letzten Woche sind einige Bestellungen eingegangen, die nun versandt werden müssen. Ich entscheide mich daher, zu Tony Hancocks Druckerei in Uckfield zu fahren, die zugleich meinen Versand mit erledigt, und dort die gesammelten Briefe und Päckchen abzugeben. Während ich meine Sachen richte, bekomme ich einen Telefonanruf von Corinne Hancock, Tonys Ehefrau. Sie drängt mich, die Druckerei in Uckfield anzurufen. Aus Sicherheitsgründen wissen die weder, wo ich wohne, noch haben sie meine Telefonnummer. Wenn sie mich erreichen wollen, müssen sie immer zuerst eine dritte Person anrufen, die sich weitab jedes öffentlichen Rampenlichtes und weitab der Suchscheinwerfer der Polizei befindet, oder eben Corinne, die einzige, die in diesen Kreisen völlig unpolitisch ist. Sie interessiert sich für mein Schicksal aus rein menschlichen Gründen, weshalb ich sie als besonders verläßlich ansehe. Sicher ist sicher.
Ich rufe also in Uckfield an. Howard geht ran, mein bester Freund, der mir hilft, wo immer er kann. Er holt für mich die Post vom Postfach in Hastings ab, und ich kann seine Anschrift für meinen bürokratischen Schriftverkehr verwenden, um für das System die Illusion aufrechtzuerhalten, daß ich wirklich da wohne: Banken, Versicherungen, Steuern. Howard vergißt, mich zu grüßen. Das ist sonst nicht sein Stil:
“Irgendwer von den Medien ist hinter dir her. Der Kerl hat in meiner Wohnung eine Nachricht hinterlassen. Er muß herausgefunden haben, wo du offiziell wohnst”, teilt er mir mit.
“Wie bitte?” Ich bin verständlicherweise schockiert. “Was hat er gesagt?”
“Zuerst hat er eine Nachricht auf meinem Anrufbeantworter hinterlassen. Er will, daß du ihn zurückrufst. Aber dann muß er sich entschieden haben, vorbeizuschauen. Er hat eine handschriftliche Notiz unter meine Tür geschoben mit dem Hinweis, daß er dich treffen möchte.”
“Verdammt. Wer war es denn?”
“Ein gewisser Hastings.”
“Hastings? In Hastings? Oder ist das sein Name?”
“So heißt er.”
“Komisch. Er behauptet, daß das sein Name ist. Und für welchen Sender oder Zeitung arbeitet er?”
“The Sunday Telegraph, sagt er. Ich habe seine Nummer. Es wäre wohl ratsam, wenn du hierher kommst, damit wir das besprechen können.”
“Ja, in Ordnung, ich bin schon auf dem Wege. Wollte sowieso kommen. Bis dann.”
“Bis dann.”
Mist. Jetzt haben sie mich aufgespürt. Muß eine Folge der Real History Konferenz in Cincinnati Ende September sein. Das war mein erster öffentlicher Auftritt seit 1994, oder so, und Irving besaß die Leichtsinnigkeit, zu erwähnen, daß ich in England wohne, als er mich dem Publikum vorstellte. Das war wohl genug für die Medien, um auf mich loszugehen. Wie dem auch sei. Pack deine Sachen und ab nach Uckfield, so schnell du kannst.
Ich sammle also meine sieben Sachen, hechte ins Auto und fahre den Zufahrtsweg von Crowlink hinauf, über Viehgitter und Bodenwellen mit 50 Sachen. Die Frontstoßdämpfer sind ohnehin schon kaputt, mach dir darum also keine Sorgen. Es eilt! Ich will nur hoffen, daß sich keine Kuh und kein Schaf hinter einem Busch versteckt, wo das Vieh sich dann zu Tode erschreckt und mir auf die Kühlerhaube springt, wenn ich vorbeibrettere.
Keine Verluste, diesmal. Und weiter geht’s, von Friston runter nach Jevington. Diese Straße fährt sich wie eine Achterbahn. Die Kinder haben das Kribbeln im Bauch geliebt, wenn das Auto mit 100 Sachen über die wellige Straße schwebt. Meine Frau hat meinen Fahrstil gehaßt. Durch die Kastanienallee geht es nach Jevington rein, und weiter über Filching nach Wannock, eine Straße, die so eng und kurvig ist, daß ein entgegenkommender Laster oder Bus bei einer Geschwindigkeit von 60-80 km/h ein sicheres Todesurteil ist. Warum mache ich das? Also gut, ich weiß, ich liebe und kenne diese Straße wie keine zweite, aber ich hatte schon ein paar Beinah-Unfälle, also warum dieses Risiko? Langsam, Mann! Du bist immer noch ein Vater, und Deine Kinder würden Dich sehr vermissen! Ich beruhige mich und fahre langsamer weiter.
Sobald ich auf der A22 gen Uckfield bin, verliere ich wieder die Geduld. Hatte ich je welche? Geduld hat man vergessen, in meine Gene einzubauen, schätze ich. Ich breche also noch ein paar englische Verkehrsregeln, aber ohne Konsequenzen, wie üblich. Die sind hier sehr lax mit Geschwindigkeitskontrollen. Ich mag das.
35 Minuten später bin ich im Büro der Druckerei in Uckfield. Howard gibt mir die Telefonnummer von diesem Hastings und wiederholt, was dieser ihm gesagt hat.
“Er hat heute morgen wieder angerufen, und ich habe etwa 20 Minuten mit ihm geredet”, erklärt Howard.
“Wie lange hast du mit ihm geredet? Und was hast du ihm gesagt?”
“Nun, wir hatten eine etwa 20-minütige nette Unterhaltung. Ich habe ihm gesagt, daß du nicht bei mir wohnst und daß ich für dich nur die Post …”
“Was hast du?”
“Ich habe ihm gesagt, daß du hier nicht…”
“Wie kannst du nur? Ich meine, Ich will nicht, daß du lügst, aber warum hast du ihm überhaupt irgend etwas erzählt?”
“Nun, ich habe nicht gedacht, daß es so wichtig …”
“Hör mal! Die Kerle sind doch nicht dumm. Die können sich denken, wenn ich nicht bei dir wohne, daß ich dann woanders sein muß, und dann fangen sie wieder an herumzuschnüffeln!”
“Hey, ich tue das alles, weil ich dich mag. Ich muß es überhaupt nicht tun, und diese Art Umgangston kann ich schon gleich gar nicht haben!”
“Entschuldigung. Ich bin halt aufgeregt und hab Angst.”
“Ist schon in Ordnung. Nun, ich habe ihm gesagt, du würdest in Tunbrigde Wells wohnen.”
“In Tunbridge Wells?”
“Ja.”
“Warum?”
“Es kam mir gerade in den Sinn.”
“Ich hatte bisher einmal pro Monat meine schönsten Mittagessen in Tunbridge mit meinem Freund Robert. Das ist jetzt wohl auch hin. Na ja. Hat er es wenigstens geschluckt?”
“Anscheinend.”
“Ahh. Zumindest etwas. Und die restlichen 18 Minuten eures Gesprächs?”
“Das war’s so ziemlich.”
“Um Himmels Willen, bitte, Howard, das nächste Mal sag bitte nichts zu niemandem. Nimm bitte nur Nachrichten für mich entgegen, ja?”
“In Ordnung. Wie hat er überhaupt herausgefunden, wo ich wohne und daß das deine offizielle Adresse ist?”
“Ich nehme an übers Internet. Bei der Anmeldung von Websites bei InterNic soll man eine Straßenadresse angeben. Ziemlich dumm von mir. Ich werde das wohl jetzt ins Postfach umändern.”
“Das wäre wirklich sehr nett. Ich habe auch keine Lust, noch mehr derartige Besucher zu bekommen.”
Tony kommt zu uns aus dem Druckerraum und warnt mich:
“Hey Germar. The Sunday Telegraph ist die Wochenendausgabe des Daily Telegraph. Ich denke du weißt das, oder?”
“Grüß dich. Nein, aber jetzt weiß ich es. Das ist also die berühmte Deutschen-Hasser-Zeitung, berüchtigt für ihre Greuelpropaganda während beider Weltkriege, ja?”
“Genau. Erwarte keine Fairneß. Du läßt dich besser nicht auf die ein.”
“Und, was soll ich jetzt tun? Die sind mir auf den Fersen, richtig?”
“Jau.”
“Er wird irgendwas über mich schreiben, korrekt?”
“Ja, aber glaub bloß nicht, daß du beeinflussen kannst, was er schreiben wird!”
“Nun, eines ist sicher: Ich kann es garantiert dann nicht, wenn ich es nicht versuche. Laß mich mit ihm reden, um herauszufinden, was er will. Kann ich dein Telefon benutzen?”
“Ja, nur zu.”
Ich rufe also diesen Chris Hastings an. Er will mich so schnell wie möglich treffen, da er seinen Artikel am kommenden Sonntag veröffentlichen will. Ich hasse Drängler. Ich sage ihm, daß ich ihn in zehn Minuten zurückrufen werde, und lege auf.
“Und was jetzt?” frage ich Tony.
“Also, wenn du gehst, dann sieh zu, daß er dir keinen Ärger machen kann.”
“Wie lange fährt man von hier mit dem Zug zum Bahnhof London-Victoria?”
“Hängt davon ab, wann der Zug abfährt.”
“Können wir das herausfinden?”
“Sicher, ruf die Bahn an. Deren Nummer findest du in den Gelben Seiten.”
Gesagt, getan. Es würde ca. 80 Minuten dauern.
“Ich gebe ihm, sagen wir, drei Stunden von jetzt an, also um drei Uhr nachmittags, und behaupte, daß ich so lange brauche, um zum Treffpunkt zu gelangen: Das lenkt seine Gedanken in die falsche Richtung. Und ich gebe ihm als Treffpunkt den falschen Bahnsteig. Und keine Fotos!”
So wird’s abgemacht. Ich sage ihm, daß wir uns am Bahnsteig zehn treffen, an dem ich ankommen würde. Tatsächlich kommt mein Zug mehr als eine Stunde früher am Bahnsteig paar-und-zwanzig an. Ich vertreibe mir die Zeit, indem ich ruhelos und nervös im Bahnhof auf und ab gehe. Währenddessen bemerke ich, daß ich mich nicht rasiert habe und meine Arbeitsklamotten anhabe. Das ist ja ein schöner Aufzug für eine Star-Fotositzung, denke ich mir. Ich hoffe nur, daß er meinen Wunsch respektiert, keine Fotos zu machen, obwohl ich gestehen muß, daß ich ihm nicht traue. Um drei Uhr schließlich gehe ich zum Ausgang des Bahnsteigs 10, zu meinem Erstaunen sehe ich, daß dort Züge von Tunbridge Wells einfahren. Das paßt ja super! Jemand anderer wartet dort ebenfalls. Ich spreche ihn an, aber er reagiert nur sehr befremdet. Das war wohl der Falsche. Etwa fünf Minuten später steht er dann vor mir. Ein kleiner Kerl, etwas untersetzt, vielleicht in meinem Alter. Also gut, zugegeben, ich habe wieder mal mich als Norm gesetzt, und das sollte ich nicht tun. Er ist also von normaler Statur, und ich bin groß und schlank.
Wir einigen uns darauf, uns im Bahnhof in eine Cafeteria zu setzen. Wir kaufen uns dort etwas zu trinken. Hastings ist ein Jahr jünger als ich. Er sagt, er sei neu beim Telegraph und dies sei seine erste große Story. Ach Herr Je! Und ich werde sein erstes Opfer sein, denkt es in mir. Er braucht Erfolg. Er möchte seinen neuen Arbeitgeber beeindrucken. Das kann ja heiter werden!
Wir verbringen etwa dreieinhalb Stunden miteinander. Wir sprechen über Gott und die Welt. Ich erzähle ihm meine ganze Geschichte. Er läßt meine Worte fließen und fragt mich nur hier und da ein paar einfache Fragen. Ich berichte ihm die Geschichte meiner Verfolgung sowie über den zunehmenden Verfall der Menschenrechte in Deutschland im allgemeinen. Er akzeptiert, daß ich allerlei Einzelheiten ausbreite. Irgendwie bin ich froh, daß mal jemand von den Medien einfach nur zuhört. Was kann schon passieren? Wenn er mich so erlebt, wie ich wirklich bin und wie ich argumentiere, muß er doch merken, daß ich kein Neo-Nazi bin, wie mich die Medien immer wieder verunglimpfen. Ich hoffe wenigstens, daß er es merkt. Seltsamerweise versucht er noch nicht einmal, irgendwelche Notizen zu machen. Er scheint aber ein recht angenehmer Kerl zu sein. Aber das ist wohl eine Grundvoraussetzung für alle Journalisten, um Erfolg zu haben. Niemand würde einem Fiesling gegenüber offen sein.
Hastings beantwortet mir auch ein paar Fragen. Über das Internet hat er herausgefunden, daß ich zeitweilig in Pevensey Bay als EU-Wähler registriert war. (Wenn man sich nicht registrieren läßt, begeht man ein Delikt, und um die Polizei fernzuhalten, entschloß ich mich, das Spiel mitzuspielen, bis ich eine andere Lösung fand.) Die Wähler-Daten sind öffentlich einsehbar, erklärt Hastings. Der jetzige Eigentümer des Hauses, in dem ich einst wohnte, konnte ihm aber nur den Namen des Immobilienmaklers geben, von dem er das Haus vermittelt bekam. Dieser Händler schließlich gab ihm die Adresse meiner damaligen Vermieterin. Aber keiner von denen wußte, wohin ich umgezogen war. Ich muß Hastings wiederholt darauf hinweisen, daß ich ihm nicht sagen werde, wo ich jetzt wohne. Er gibt es schließlich nach einigen Versuchen auf.
Offenbar führen keine Spuren zu meiner neuen Wohnung. Gut gemacht, Germar! Zumindest das hat geklappt!
Gegen Ende unseres Gesprächs ruft er seine Freundin an, die ihn am Bahnhof abholt. Wir verabschieden uns, und ich gebe vor, zum Bahnsteig zehn zu gehen. Aber bevor ich die Richtung zu meinem wirklichen Bahnsteig wechsele, versichere ich mich, daß er wirklich weg ist.
Am Sonntag Abend bekommen ich noch einen Anruf von Corinne. Der Telegraph-Artikel ist erschienen. Sie will, daß ich zu ihr komme. Ich springe also in meinen Wagen und fahre die 60 km gen Westen zu ihrem Haus in Hove. Im Hause Hancock werde ich freundlich empfangen und Corinne gibt mir sogleich den Zeitungsartikel.
“Tony hat versucht, die Zeitung vor mir zu verstecken”, sagte sie.
“Das stimmt nicht” erwidert er.
“Das stimmt ja doch! Du hast die Zeitung mitgenommen, damit ich sie nicht sehe!”
“Würdet ihr mir den Gefallen erweisen und mich den Artikel erst mal lesen lassen, bevor ihr euch zu streiten anfangt?” werfe ich ein.
Das Hauptanliegen des Artikels ist offenbar, mich als Neo-Nazi zu verunglimpfen und Stimmen von Persönlichkeiten zu sammeln, die meine Auslieferung an Deutschland fordern.
“Zumindest hat Hastings Howards Geschichte geschluckt, daß ich in Tunbridge wohne,” merke ich an. “Und das Bild von mir ist so schlecht, daß mich niemand darauf erkennen kann. Das ist auch ein Vorteil. Irgend jemand muß mich aus der Distanz fotografiert haben, als ich Hastings die Hand gab.”
Corinne hat wirklich schlechte Laune. Sie verdächtigt ihren Mann, daß er wieder versucht hat, vor ihr zu verbergen, daß Ärger in der Luft liegt, wie er dies schon mehrmals zuvor versucht hat.
“Welche Art von Verbindungen hast du eigentlich zu Rechtsextremisten geschmiedet?” fragt sie mich.
“Nun, ich war wohl Hastings gegenüber zu ehrlich,” antworte ich. “Er hat mich gefragt, ob ich in England Kontakt zu Personen der politischen Rechten gehabt habe.”
“Und, was hast du ihm gesagt?”
“Die Wahrheit. Ich meine, daß ich David Irving getroffen habe, war nicht Teil meiner Antwort, da ich ihn nicht als Teil einer politischen Bewegung ansehe. Irving war schlicht eine Station bei meiner Übersiedlung nach England, und das habe ich Hastings gegenüber wohl erwähnt.”
Gegen Ende Mai 1996, etwa zwei Monate nachdem ich von Deutschland nach Spanien geflohen war, erfuhr ich, daß die Spanier gerade ein anti-revisionistisches Gesetz erließen. Ich teilte daher meiner Frau mit, daß ich lieber mit der ganzen Familie nach England gehen würde, wo kein derartiges Gesetz geplant war. Sie war froh, dies zu hören, da keiner von uns Spanisch sprach und ihr Spanien kulturell zu fremdartig war. Ich fing also an, einen Weg zu suchen, wie ich nach England kommen könnte. David Irving, der weltberühmte britische Historiker, war die einzige Person, die ich in England zumindest flüchtig kannte. Ich hatte ihn 1991 in Deutschland während einer Vortragsveranstaltung getroffen. Damals hatte ich ihm eine frühe Fassung meines Gutachtens übergeben, weshalb ich hoffte, daß er sich an mich erinnern würde. Ich rief ihn von Estepona aus an, und er war bereit, mich zu empfangen. Er beschrieb mir, wie ich von Heathrow zu seiner Wohnung gelangen könne. Er hatte dann allerdings praktisch keine Zeit für mich, und ich war am ersten Abend nur Babysitter für seine 2½-jährige Tochter. Ich selbst übernachtete einige Tage in einer billigen, schmuddeligen Absteige hinter dem Bahnhof Victoria, von wo aus ich herauszufinden versuchte, ob ich meine Doktorarbeit vielleicht an einer englischen Universität fertigstellen könnte. Später, im Herbst 1996, als ich in Pevensey Bay wohnte, habe ich dann Irving auf seine Bitte hin als Beifahrer in einem Kleinlaster während einer Buchauslieferungstour zu verschiedenen Großhändlern durch Südostengland begleitet. Während dieser Tour frug er mich, ob ich als Zeuge in seinem anstehenden Prozeß gegen Deborah Lipstadt aussagen wollte, und ich erklärte mich damit einverstanden. Ich habe dann nie wieder von ihm in dieser Sache gehört.
“Und was ist mit der National Front und der British National Party?”[1]
Corinne kann all dieses rechte Zeug nicht ausstehen. Sie verachtet es.
“Ich habe Hastings gesagt, daß ich 1998 von einem englischen Zensurfall gegen einen Kerl namens Nick Griffin erfahren hatte. Du kennst doch den Fall Griffin, oder?”
“Nein, ich weiß gar nichts über diesen Kerl und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich was wissen will” beeilt sich Corinne zu bekräftigen.
“Nun, Griffin hatte in seinem Magazin ‘Rune’ einen Artikel veröffentlicht, in dem er irgendwie den Holocaust bestritten hatte, und zudem wurde er wegen Aufstachelung zum Rassenhaß gegen Schwarze angeklagt. Da ich sehr an der britischen Gesetzgebung und Rechtspraxis hinsichtlich Holocaust-Revisionismus interessiert war und wissen wollte, welche Art von ‘Aufstachelung zum Rassenhaß’ als Verbrechen angesehen wird, wollte ich mehr über diesen Fall erfahren. Schließlich konnte mein eigenes Schicksal davon abhängen. Und außerdem widmet sich meine Geschichtszeitschrift ja selbst dem Kampf gegen Zensur. Da ich über den Fall berichten wollte, brauchte ich weitere Informationen. Ich nahm also mit Griffin per Email Kontakt auf. Ich wußte damals nicht, ob er irgendwie politisch tätig war. Alles, was ich wußte, war, daß er irgendwie der BNP nahestand. In seiner Antwort schrieb er, er habe von meinem Fall gehört, und er lud mich zu sich nach Wales ein. Das war im Februar 1999. Meine Familie hatte mich gerade einen Monat zuvor verlassen, und in dieser Zeit hatte ich schreckliche Alpträume, daß ich meine Kinder und meine Frau verlieren würde. Ich war froh, mal aus meinen vier Wänden herauszukommen und etwas Ablenkung zu finden von meiner mißlichen Lage. Ich nahm daher diese Gelegenheit wahr, meiner Einsamkeit zu entfliehen. Die Zeit bei Griffin war wirklich schön. Wir sprachen über unsere Familien und unsere persönlichen Schicksale, über die ethnische und Sprachensituation in Wales, und natürlich über den Holocaust-Revisionismus und über Zensur in England. Erst bei diesem Besuch erfuhr ich über Griffins führende Rolle in der BNP und, daß er drauf und dran war, den seinerzeitigen Parteivorsitzenden herauszufordern. Das war es, was ich Hastings erzählte.”
“Und die National Front?”[2]
beharrt Corinne.
“Ich kann mich da an nichts erinnern. Ich weiß noch nicht mal, ob ich überhaupt jemals mit irgend jemandem von der NF Kontakt hatte. Hastings muß das einfach hinzugefügt haben.”
“Ich hätte nicht gedacht, daß du so naiv bist. Warum hast du Hastings das überhaupt erzählt?” fragt Corinne entrüstet.
“Ich sag nur die Wahrheit! Ich fang doch nicht wegen so einem Typ wie Hastings plötzlich an zu lügen!”
“Es geht doch nicht ums Lügen”, wirft Tony ein, “es geht hier um Vorsicht und darum zu schweigen, wenn es nötig ist.”
“Wie auch immer, dafür ist es jedenfalls jetzt zu spät. Ich kann’s nicht mehr rückgängig machen. Ich habe dreieinhalb Stunden mit Hastings über Menschenrechte, Zensur, Bücherverbrennung und Verfolgung geredet, und alles, was der dazu zu sagen hat, ist ‘NAZI’, und wie ich angeblich Verbindungen zu Rechtsextremisten geschmiedet hätte.”
Corinne, Tony und ich beschließen, zunächst einmal abzuwarten und zu beobachten, was passiert. Inzwischen quillt meine Emailbox über vor Nachrichten von Freunden aus aller Welt, die den Artikel des Sunday Telegraph per Email bekommen haben. David Irving wird massiv. Er droht mit Konsequenzen, falls sich der britische Staat an mir vergreifen sollte. Ich weiß nicht, was er damit meint. Immerhin hat er keinerlei Möglichkeiten, irgendwelche Konsequenzen umzusetzen. Aber zumindest zeigt er Solidarität, und dafür bin ich ihm dankbar. Er fürchtet womöglich, daß er der nächste sein könnte, wenn sie erst einmal anfangen, dissidente Historiker in Gefängnisse zu sperren.
David Botsford von der Libertarian Alliance schreibt mir in einem rührigen Brief, ich solle auf mich aufpassen. Er bietet mir umfangreiche Unterstützung an, sollte ich untertauchen müssen. Er weiß offenbar nicht, daß ich seit Mitte 1997 bereits untergetaucht bin. Ich habe David Botsford nie getroffen, aber wir kamen gut miteinander aus, als ich mit ihm an der Übersetzung, Aktualisierung und Veröffentlichung seines Werkes über Geschichtsschreibung und Zensur arbeitete. In diesem Jahr der Zusammenarbeit haben wir entdeckt, daß unsere Ansichten recht ähnlich sind. Es ist schön zu sehen, daß mir all diese Leute ihre Hilfe anbieten.
Inzwischen posaunen die Medien in Deutschland die vom Telegraph präsentierte heiße Nachricht heraus: “Neonazi”, “Rassist”, “Faschist”, “Antisemit”. Ich fange an, mich selbst zu hassen für dieses Ekelpaket von leibhaftigem Teufel, als den mich die Medien darstellen. Wie können Menschen nur so gemein sein und andere dermaßen herabsetzen, ohne sie zu kennen?
Meine Frau macht sich Sorgen, ob es ihr überhaupt möglich sein wird, mich zu besuchen und bei mir für ein paar Tage zu übernachten. Sie befürchtet, daß ich wieder mal Hals über Kopf abhauen muß. Ich versuche sie zu beruhigen:
“Keine Sorge. Hier ist alles beim alten. Nichts ist passiert. Das war nur die aufgeblasene Story eines profil-neurotischen jungen Reporters. Er mußte seinen Arbeitgeber beeindrucken, und es ist schließlich immer einfach, eine “Nazi-Sau” durchs Dorf zu treiben. Diesmal bin halt ich die Sau, aber die Dinge werden sich hier auch bald wieder beruhigen.”
Obwohl bereits Ende Oktober, ist das Wetter immer noch recht schön. Dieser Sommer war extrem warm und trocken, und es scheint, als wolle er überhaupt nicht aufhören. Sonnenschein dominiert immer noch. Ich mache wie immer fast täglich meine 25 km Fahrradtour auf meinem geliebten Rennrad durch saftige Weiden voller Kühe und Schafe entlang der Seven Sisters und an Litlington vorbei, eine herrliche Aussicht genießend. Jedesmal versuche ich, meine eigene Bestzeit zu unterbieten, und ich bin stolz, daß ich die anfänglichen 65 Minuten nun schon auf 45 Minuten heruntergedrückt habe. Jedes Mal, wenn ich diese Tour hinter mich gebracht habe, fühle ich mich großartig. Am Tag vor der Ankunft meiner Familie bekomme ich jedoch leider einen Platten, so daß ich nicht mehr fahren kann, bis das repariert ist. Und da ich damit keine Zeit verschwenden will, solange meine Familie da ist, verlege ich alles auf die Zeit danach. Ich wußte damals nicht, daß dies das letzte Mal sein würde, daß ich diese absolut fantastische Fahrradtour machen kann, und daß ich dieses Naturerlebnis, die Landschaft und das Körpergefühl noch mit am meisten vermissen würde.[3]
Am Freitag jedenfalls, meinem Geburtstag, hole ich meine Familie vom Flughafen in Heathrow ab. Die Zeit mit ihr ist wunderbar. Am Samstag besuchen wir Hastings Castle und die Schmuggler-Höhlen. Die Kinder sind wie im Himmel und Papa auch. Wir verbringen die Nacht alle zusammen in meinem großen, 2,20 m langen und 2 m breiten Doppelbett, und keine Nacht ist entspannender als diejenige, in der ich die Hand meiner Tochter und meines Sohnes halten kann, während sie einschlafen. Oder ist es anders herum? Wen kümmert’s…
Am Sonntag Morgen erhalte ich wieder einen Alarm-Anruf von Corinne:
“Sie haben wieder einen Artikel im Telegraph über dich gebracht. Du mußt das sehen. Es wird jetzt ernst. Komm so schnell wie möglich hierher, schnell!” drängt sie. Sie macht mir Angst.
Ich sage es meiner Frau, und sie ist entsetzt. Jetzt müssen wir schnell reagieren. Sie meint, ich könne sie und die Kinder bei Schumachers abladen, einer deutschen Familie, Freunde von uns, die einige Kilometer entfernt in Stone Cross wohnen. Ich müßte ja nicht mit zu ihnen kommen. Ich bin damit einverstanden. Wir packen also unsere Sachen, und ich lasse sie bei Schumachers raus. Dann fahre ich weiter zu Hancocks. Die Atmosphäre im Hause Hancock ist eisig. Diesmal gibt es kein herzliches Willkommen und keine Umarmungen wie sonst üblich. Sie zeigen mir den Artikel. Ich fange an zu lesen:[4]
“Deutschland strebt Auslieferung Rudolfs an”
Ich habe plötzlich einen dicken Kloß im Hals.
“Ein flüchtiger Krimineller, der vom Telegraph in England aufgespürt wurde, sieht sich nun von seiner Auslieferung bedroht.
Hohe Beamte der Deutschen Botschaft in London haben bestätigt, daß Schritte unternommen wurden, um Germar Rudolf nach Deutschland zurückzubringen.”
Und so weiter, und so fort. Ich wußte seit 1997, daß die Lage kritisch ist, zumal ich für etwas verurteilt worden war, das – formell gesehen – auch in England strafbar ist. Ein Anwalt hatte mir bereits 1997 mitgeteilt, daß die Dinge für mich nicht gut aussehen. Ich hatte einfach gehofft, daß sich England mit seiner Tradition der Meinungsfreiheit und seiner antideutschen Politik nicht deutschen Befehlen beugen würde. Ich lag wohl falsch. Deutschlands Politik ist antideutsch, und da ist es wohl jedem Briten eine Ehre, dies zu unterstützen.
“Und nun?” frage ich Tony.
“Wir müssen jetzt vorausplanen” sagt er.
“Ich gehe davon aus, daß sie mich jetzt aktiv suchen, wenn nicht jetzt, dann doch in einer Woche oder so.”
“Es sieht nicht gut aus. Zuallererst mußt du sofort aus deiner Wohnung verschwinden. Du brauchst zunächst eine Unterkunft irgendwo anders, wo dich niemand kennt”, schlägt Tony vor.
“Ich glaube nicht, daß sie so schnell reagieren. Ich lebe hier unter einer anderen Identität, und außer meiner Familie weiß niemand, wo ich wohne. Noch nicht einmal ihr. Es wird Monate dauern, bis sie herausfinden, wo und unter welchem Namen ich lebe, falls es ihnen überhaupt gelingt. Immerhin habe ich ja hier kein einziges Verbrechen begangen. Die werden daher Wichtigeres zu tun haben, als Gespenster zu jagen.”
“Und was ist, wenn sich dein Immobilienhändler an dich erinnert, oder wenn sie anfangen, Bilder von dir in den Medien zu zeigen und die Bevölkerung auffordern, dich zu suchen? Oder wenn sie Telefone oder deinen Internet-Server abhören? Wenn sie dich wirklich aufspüren wollen, dann finden sie dich auch.” widerspricht Tony.
“Nun mal’ nicht den Teufel an die Wand. So wichtig bin ich auch wieder nicht”, versuche ich ihn zu beschwichtigen.
“Germar, wir können dir aus diesem Schlamassel heraushelfen. Aber, Germar, schau mir in die Augen” meint Corinne. Jetzt legt sie wieder los, denk ich.
“Du weißt, daß ich dich mag als Mensch”, fährt sie fort. “Wenn ich dir meine Hilfe anbiete, dann muß ich sicher sein, daß du mich nicht anlügst. Schau mir in die Augen!
Gut. Ich habe dich das schon öfter gefragt, und ich frage dich wieder: Hast du je irgendwas mit Neo-Nazi-Zeug zu tun gehabt?”
“Ich habe dir das doch schon so oft gesagt: Nein, habe ich nicht”, antworte ich.
“Kannst du beschwören, daß das stimmt?” hakt sie hartnäckig nach.
“Jawohl, das kann ich,” bestätige ich, “und ich tue es hiermit wieder. Du kennst die Geschichte doch. Du weißt, warum ich den ganzen Ärger habe. Es ist wegen der Kommentare, die Wolfgang meinem Gutachten hinzugefügt hat, ohne mich darüber zu informieren. Und noch nicht einmal diese Kommentare waren irgend etwas Nazihaftes. Sie waren nur emotional, unkontrolliert und dumm. Alles Material, das ich veröffentlicht habe, ist strikt wissenschaftlich.”
“Ich kann kein Deutsch lesen, ich muß dir daher trauen”, erwidert Corinne. “Ich hasse dieses Nazischwein Wolfgang.[5]
Er hat dein Leben zerstört, und uns hat er auch jede Menge Ärger eingebracht.”
“So einfach ist das nun auch wieder nicht”, werfe ich ein.
“Doch, es ist so einfach. Jeder macht Fehler, aber im Gegensatz zu dir entschuldigt er sich nie. Er beschuldigt immer nur andere und wird aggressiv, wenn man ihm seine Verfehlungen, schlechten Manieren und Fehler vorhält.”
“Was hat das jetzt mit unserem Problem zu tun”, versucht Tony zu unterbrechen.
“Sehr viel, weil Wolfgang hier nämlich die Ursache unseres Problems ist. Horch, Germar! Sollte ich jemals herausfinden, daß du mich angelogen hast, daß du tatsächlich in irgendwelches Nazizeug verstrickt warst, dann werde ich nicht zögern, alle Informationen über dich an die Polizei weiterzugeben.
Aber wenn du recht hast, und ich hoffe und glaube dir, daß dem so ist, dann verdienst du unsere Hilfe. Du weißt, daß ich dich mag. Du bist nicht einer dieser Nazi-Bastarde, mit denen sich Tony sonst so umgibt. Ich werde dir also helfen. Ich werde alles riskieren, um dir aus diesem Schlamassel rauszuhelfen. Ich werde die dreckigsten Lügen erzählen, die du je gehört hast, um dir zu helfen. Sieh mir in die Augen! Wenn du mich angelogen hast, dann kriegst du einen Riesenärger, das verspreche ich dir!”
Das ist Corinne live! Es hat zwei Jahre gebraucht, bis ich verstanden habe, daß dieses ihr Verhalten, ihre Art ist, um Leuten ihre Zuneigung mitzuteilen. Tony ist ein äußerst duldsamer Ehemann. Obwohl ihn seine Frau ständig beschimpft, steht er nur daneben und lächelt. Ich frage mich, was er in solchen Augenblicken wohl denkt.
“Du kannst heute Nacht bei uns schlafen”, bietet Corinne mir an.
“In Ordnung. Danke. Aber ich muß zuerst zurück nach Hause, den Rest des Tages mit meiner Familie verbringen, mit meiner Frau besprechen, wann ich sie morgen zum Flughafen bringe, und dann einige wichtige Dokumente und meinen Computer sicherstellen. Ich werde dann später am Abend zu euch kommen. In Ordnung?”
“Das geht in Ordnung. Wir warten hier auf dich.”
“Gut. Danke. Bis dann, tschüß!”
“Tschüß”
Ich gehe zu meinem Auto, setze mich hinters Steuer, verschnaufe für ein paar Sekunden und versuche, mich von Corinnes Standpauke zu erholen. Dann fahre ich zurück nach Hause, um Waschbeutel, Schlafanzug, Schlafsack, meinen Rechner und ein paar wichtige Dinge einzupacken. Als ich mich auf meinem Nachhauseweg dem Parkplatz unmittelbar vor dem Viehgitter nähere, sehe ich dort einen sinnlos geparkten blauen BMW, in dem zwei Männer mittleren Alters sitzen und sich umschauen. Sobald ich sie passiere, starten sie ihren Wagen und folgen mir. Ich krieg die Panik und fahre den mit Schlaglöchern übersäten asphaltierten Weg mit 60 km/h runter. Mein armer Renault Clio. Sie folgen mir nicht derart schnell. Ich hechte schnell in meine Wohnung, sammle die wichtigsten Sachen zusammen und fahre gleich wieder zurück. Ich kann den anderen Wagen nirgends sehen. Vielleicht bin ich nur paranoid.
Anschließend hole ich meine Familie bei Schumachers ab, und wir verbringen den Rest des Nachmittages in einem Vergnügungspark für Kinder. Ich spiele mit den Kindern, und versuche, die Umstände meiner momentanen Existenz zu verdrängen. Im besagten Vergnügungspark treffen wir zufällig auf ein paar alte Nachbarn von unserer gemeinsamen Zeit in East Dean, einschließlich der früheren Freundin meiner Tochter Tamara. Die Kinder haben viel Spaß miteinander. Tamara kramt ihr nunmehr gebrochenes Englisch aus. Vor einem Jahr noch war sie perfekt zweisprachig. Kaum 10 Monate in Deutschland, und vieles ist vergessen. Kay, mein Sohn, hat alles vergessen. Er war erst knapp drei, als ihn seine Mutter nach Deutschland brachte. Er versteht hier nur noch Bahnhof. Tamara aber erinnert sich recht schnell wieder, einschließlich des netten südostenglischen Akzents. “Noi” sagen sie hier für No, so wie auch die Schwaben “Noi” sagen, wenn sie Nein meinen. Meine Kinder wachsen nun im Schwabenländle auf. Lustig, diese Parallele. Und bei all dem Spaß, den die Kinder haben, tun die Eltern so, als sei alles in Ordnung…
Um die Abendessenszeit geht es dann heimwärts nach Crowlink. Unterwegs beschließen wir, am morgigen Montag mit dem Zug nach London zu fahren und den dortigen Zoo zu besuchen, alleine schon, damit wir nicht zuhause sind und dort angetroffen werden können. Ich sag den Kindern, daß ich heute Abend leider nicht bei ihnen sein kann. Diesmal muß meine Frau ihnen das Abendessen bereiten und sie ins Bett bringen. Sie ist das zwar von Deutschland gewöhnt, aber sie ist dennoch etwas enttäuscht darüber. Ich hoffe bloß, daß die Kinder nicht fragen, wo und warum der Papa heute Nacht nicht bei ihnen ist. Denn sind sie nicht diese tausend Kilometer gereist, um seinen Gutenacht-Geschichten zuzuhören und mit ihm zusammen einzuschlafen? Es tut weh, auch nur daran zu denken, meine Kinder zu enttäuschen – und mich selbst, zugegebenermaßen.
Sobald die Kinder die Autotür zugeschlagen haben, fahre ich zurück nach Hove. Dort angekommen bemerke ich, daß ich mein Portemonnaie vergessen haben. Verflixt, das wichtigste von allem. Also wieder zurück. Das Wetter hat sich nun der Stimmung angepaßt. Es bläst ein starker Westwind. Obwohl es bereits dunkel ist, wage ich nicht mehr, den normalen Weg zu meiner Wohnung zu nehmen, so nervös bin ich inzwischen. Ich lasse meinen Wagen in einem Feldweg bei Birling Gap stehen, gehe zu Fuß über die Weiden und nähere mich meiner Parterre-Wohnung von hinten. Der Wind ist dermaßen stark auf den drei Anhöhen der berühmten Seven Sisters, die ich auf meinem Weg passieren muß, daß ich mich ganz vornüber beugen muß, um die Balance zu halten. Weiße Gischtbälle von der Größe einer Faust jagen vom Meer die Klippen hinauf und über die Downs. Was für eine perfekte Anpassung des Wetters an meine Stimmung!
In dem kleinen Tal, in dem die Siedlung Crowlink eingebettet ist, scheint aber alles friedlich zu sein. Ich klopfe ans Fenster, und nach einigen Sekunden macht meine Frau die Terrassentüre auf. Ich frage sie, wie die Kinder meine Abwesenheit aufgenommen hätten, und sie meint, alles sei in Ordnung. Sie waren zwar nicht allzu glücklich, aber auch nicht übermäßig traurig. Ich sage ihr, daß ich mein Portemonnaie vergessen habe. Sie lacht.
“Wenn dein Kopf nicht angewachsen wäre, würdest du den auch noch vergessen, wie?”
Ich grinse und gebe ihr einen Kuß auf die Wange. Wir einigen uns auf eine Zeit, zu der ich sie am nächsten Morgen abhole, um sie zum Flughafen zu bringen. Ich bitte sie, die Sachen so weit vorzubereiten, daß wir alles schnell in den Kofferraum werfen und sofort abfahren können. Ich würde ungern längere Zeit hier sein wollen. All diese Nervosität und Angst, die durch meine Instruktionen durchscheint, macht sie ebenso unruhig.
“Soll ich mir nicht lieber ein Taxi nehmen, das uns zu einem Treffpunkt bringt, wo uns niemand vermutet?”
“Ich glaube nicht, daß es wirklich ein Risiko gibt”, versuche ich zu erläutern. “Ich möchte nur das Restrisiko minimieren. Das ist alles. Mach dir also keine Sorgen. Das geht schon gut.”
Wir umarmen uns ein letztes Mal.
“Paß gut auf dich auf.”
Die Stimme meiner Frau ist erfüllt von Sorge.
Ich verlasse die Wohnung wieder durch die Terrassentür und steige über den Grundstückszaun. Rrrraaaattttsssccchhhh. Ein rostiger Nagel in einer Latte hat etwas gegen meine Hose. Gott sei Dank beschränkt sich der Schaden auf den Stoff. Schöne Bescherung! Jetzt, da ich all meine Pfennige zusammenhalten muß, fang ich auch noch an, meine Kleidung zu zerfetzen. Großartig!
Nach dem Marsch durch die Weiden zurück zum Auto geht es dann zurück nach Hove. Irgendwie bin ich nicht allzu glücklich darüber, bei Hancocks zu übernachten. Würde die Polizei nicht schnell herausfinden, daß Tonys Druckerei eine wichtige Rolle in meinen Geschäftsangelegenheiten spielt? Wäre das also nicht ein Ort, wo sie zuerst nach Informationen über meinen Aufenthaltsort suchen würde? Ich werde den Eindruck nicht los, daß ich vom Regen in die Traufe komme.
Ich parke mein Auto einige Blocks abseits von Hancocks Haus. Sicher kennen sie mein Auto und mein Kennzeichen und werden danach Ausschau halten. Also ist es gut, es nicht gleich neben Tonys Haus zu parken. Den Rechner lasse ich im Auto (was mich nervös macht), und ausgerüstet mit Waschbeutel, Schlafanzug, Schlafsack und Papieren geht es durch Hoves abendliche Straßen. Corinne heißt mich im Hause Hancock willkommen. Sie führt mich geradewegs ins Dachgeschoß, wo sie ein altes ausziehbares Sofa hat. Ich hasse diese Möbelstücke. Am nächsten Morgen steht man meistens mit Kreuzschmerzen davon auf. Decke und Kissen, die ich ausgehändigt bekomme, sehen auch erbärmlich aus. Aber ich bin wohl kaum in der Lage, mich über solche Nebensächlichkeiten beschweren zu können. So ist denn auch das erste, was ich mache, nach guten Versteck- und Fluchtmöglichkeiten Ausschau zu halten für den Fall, daß Polizei hier auftaucht: Aus einem Dachgeschoß-Fenster, das zum Garten hinter dem Haus hinausführt, kann man leicht aufs Dach klettern und von da runter in den Garten gelangen. Ich werde langsam paranoid.
Die Nacht vergeht ohne besondere Vorkommnisse, ausgenommen vielleicht, daß ich ziemlich mies schlafe. Ich stehe daher früh am Morgen auf, noch vor der Dämmerung. Tony macht sich gerade fertig, um zur Arbeit zu gehen. Er sagt, er werde sich heute bei verschiedenen Leuten erkundigen, wo ich am besten dauerhaft und sicher unterkommen könnte. Seiner Meinung nach müßte ich ab jetzt in Wohnungen leben, die mir von zuverlässigen Freunden vermietet werden, nicht mehr von wildfremden Menschen. Die Freunde könnten mir dann helfen, eine ganz neue Identität aufzubauen. Das alleine würde garantieren, daß wirklich kein Dritter weiß, wer ich bin und woher ich komme. Das sind ja schöne Aussichten, denke ich mir. Ich werde mich also noch tiefer in die englische Muttererde eingraben…
Etwa eine Stunde später sitze ich mit Corinne beim Frühstück in der womöglich dreckigsten Küche der Welt. Ich habe halt meinen deutschen Sauberkeits- und Ordnungssinn immer noch nicht verloren …
Etwa eine weitere Stunde später fahre ich gen Crowlink, um meine Familie von meiner Wohnung abzuholen. Wie ich mich dem Viehgitter nähere, über das ich fahren muß, um zu dieser abgelegenen Siedlung zu kommen, frage ich mich, was aus diesem seltsamen BMW geworden ist. Gerade als ich in die Sackgasse zu meiner Wohnung einbiege, sehe ich ihn auf dem Parkplatz meines Nachbarn stehen. Mhhh, das sind wohl nur Besucher, die den Weg nicht kannten! Die sind mir demnach gestern nicht etwa gefolgt, um mir Handschellen anzulegen, sondern weil ich ihnen den Weg zur verlorenen Welt von Crowlink gewiesen habe. Ein großes Schild an dem Viehzaun erinnert die Leute daran, daß jenseits des Viehgitters keine Autos erlaubt sind, und überhaupt, wer will schon in eine Kuhweide fahren? Die meisten Menschen können sich daher nicht vorstellen, daß sich in diesem Tal hinter einer dichten Wand von Bäumen Häuser verstecken. Dieser Ort ist in der Tat ideal für Leute, die völlig von der Welt abgeschnitten sein wollen. In diesem Tal gibt es kein Handy-Signal, und nur ganz wenige Radio- und Fernsehprogramme kann man dort in sehr schlechter Qualität empfangen. Als ich eine ISDN-Leitung installiert haben wollte, wußte die British Telecom nicht, wo der Ort war. Die hatten Schwierigkeiten, ihre eigene Ausrüstung zu finden…
Als ich aus dem Auto aussteige, grüßt mich mein dortiger Nachbar Andrew, der wieder mal an seinem Auto rumbastelt:
“Hallo Michael, wie geht’s?” fragt er mich.
“Danke gut. Und dir?”
“Danke.”
Er hat also den Telegraph-Artikel nicht gelesen, oder zumindest konnte er mich anhand dessen nicht identifizieren. Mein Pseudonym ist also noch sicher.
Ich erzähle meiner Frau von dem BMW, und sie atmet erleichtert auf. Anschließend lassen wir uns alle Zeit der Welt, um all die Klamotten meiner Familie ins Auto zu packen. Dann geht es zum nächsten Bahnhof und ab nach London. Die Kinder sind ganz aus dem Häuschen. Zugfahren ist für sie weitaus ungewöhnlicher als fliegen. So ändern sich die Zeiten! In London bahnen wir uns per U-Bahn und Bus den Weg zum Zoo. Der stellt sich dann allerdings als recht enttäuschend heraus, was wohl auch an der fortgeschrittenen Jahreszeit liegen mag. Viele Tiere sind einfach nicht in den Freigehegen. Aber auch sonst scheint dieser Zoo für diese 10-Millionen-Stadt zu winzig zu sein. Jedenfalls meint meine Frau, die Wilhelma in Stuttgart sei wesentlich schöner. Aber zumindest die Kinder sind zufrieden. Gegen 3 Uhr nachmittags müssen wir uns dann zum Flughafen aufmachen. Wir warten fast eine halbe Stunde vergeblich auf den Bus. Um zu verhindern, daß wir zu spät kommen, entschließe ich mich, das Taxi zur nächsten U-Bahn-Haltestelle zu nehmen. Ich nehme Kay auf die Schulter und alles mögliche Gepäck auf den Rücken und unter die Arme und hechte los. Meine Frau und Tamara haben Probleme, mir zu folgen. Ich finde gewandt meinen Weg durch Londons etwas verwirrendes U-Bahn-System von einer Linie zur nächsten, treppauf, treppab, linker Gang, rechte Röhre, Linie 1 zur Linie 14, treppauf, links herum, treppab, dann auf die Linie 4 gewechselt. Alles muß schnell gehen, und so habe ich die völlig irritierte und orientierungslose Familie im Schlepptau.
“Woher weißt du bloß, daß wir richtig sind? Wo sind wir überhaupt? Ich wäre hier völlig verloren, wenn ich dich nicht hätte” meint meine Frau.
“Ich hab’ halt begriffen, wie es hier funktioniert. Vertrau einfach auf mich. Wir haben jetzt keine Zeit.”
Erst in der Linie raus nach Heathrow kommen wir zur Ruhe, und ich erkläre ihr, wie das U-Bahn-System funktioniert und warum ich mich ein wenig auskenne. Erfahrung eben.
Während unserer etwa 45-minütigen Fahrt raus nach Heathrow erkläre ich meiner Frau, daß ich aus Sicherheitsgründen lieber nicht mit ihr zum Schalter gehe. Ich werde statt dessen im Hintergrund warten, während sie sich einbucht.
“Ich verstehe”, sagt sie.
“Ich glaube nicht, daß es wirklich gefährlich werden kann, aber es ist theoretisch möglich, daß sie wissen, daß du hier bist und wann du abfliegst. Sie könnten es zumindest wissen, falls sie Zugriff auf die Flugdaten haben. Ich muß dich wohl nicht daran erinnern, daß sie 1995 Günter Deckert in Handschellen vom Flughafen abgeführt haben, als er gerade aus dem Flugzeug ausstieg. Er kam von einem Urlaub auf den Kanarischen Inseln zurück, und sie wußten genau, wann er aus welchem Flugzeug aussteigen würde. Sie sind also absolut in der Lage, so was zu machen.”
Günter Deckert war in Deutschland strafrechtlich verfolgt worden, weil er 1991 einen “Holocaust-leugnenden” Vortrag des US-Bürgers Fred Leuchter übersetzt hatte, einem Experten für Hinrichtungstechnologien, der 1989 ein Gutachten über die angeblichen Gaskammern von Auschwitz und Majdanek angefertigt hatte. Leuchter war in seinem Gutachten zu dem Schluß gekommen, daß es solche Gaskammern nicht gegeben habe, und diesen Bericht hatte er in besagtem Vortrag auf Englisch zusammengefaßt. Deckert wurde später für seine Übersetzung zu zwei Jahren Haft verurteilt. Daß er Deutschland während des laufenden Verfahrens für einen Urlaub verlassen hatte, wurde von dem deutschen Gericht unglaublicherweise als Fluchtversuch interpretiert. Hätte Deckert wirklich fliehen wollen, wäre er wohl kaum zurückgekehrt.
Ich habe ein Talent dafür, meiner Frau Angst einzujagen. Ich berichte ihr meist ohne Umschweife über die Risiken und Gefahren dessen, was ich mache. Es liegt wohl in meinen Genen. Im Lügen war ich schon immer schlecht. Meine Frau hat das nach nur wenigen Monaten, die wir zusammenlebten, spitz gekriegt. Sie sieht es mir an der Nasenspitze an, wenn ich etwas zu verbergen suche. Jeder kann dies nach einer Weile. Schon während meiner Kindheit sind die wenigen Versuche, zu flunkern, fürchterlich daneben gegangen, und so habe ich es mir zum Prinzip gemacht, nicht zu schummeln. Das geht häufig soweit, daß ich nicht nur nicht zu lügen versuche, sondern die Dinge demonstrative offen präsentiere. Das hat mich freilich auch schon immer wieder in große Schwierigkeiten gestürzt, schon als Kleinkind, wie meine Mutter zu berichten weiß. Meine Ehrlichkeit und Wahrheitsliebe, so ihre Aussage, würde mir noch zum Verhängnis werden.
Im Heathrow Flughafen halte ich mich dann auch wirklich im Hintergrund, während meine Frau sich und die Kinder einbucht. Ich sehe die irritierten Blicke meiner Kinder, die mich aus den Augen verloren haben und nun die Menschenmenge nach mir absuchen. Ich hoffe, daß sie mich nicht sehen, denn es kann schlimme Auswirkungen haben, wenn sie plötzlich laut “Papa” und “Germar” rufend quer durch die Abfertigungshalle zu mir gerannt kommen. Es tut weh, die Kinder so verstört zu sehen.
Und dann geht tatsächlich etwas schief. Die Dame am Schalter nimmt die Flugkarten meiner Frau und verschwindet damit für 5 bis 10 Minuten. Ich werde nervös. Aber schließlich stellt sich heraus, daß es nur ein Problem mit der Reservierung war. Sobald sie ihr Gepäck los ist, macht sich meine Frau, die mich ebenfalls aus den Augen verloren hat, mit den Kindern und dem Handgepäck auf den Weg. Sobald sie in der Menschenmenge verschwunden ist, pirsche ich mich ran und helfe ihr beim Tragen des Gepäcks. Wir verbringen etwa eine halbe Stunde in einem Restaurant und gehen dann zur Personenkontrolle.
“Würdest du mir den Gefallen erweisen und nicht wieder zu weinen anfangen, wenn wir uns verabschieden?” bittet mich meine Frau. “Sonst sitzen wir nämlich nachher alle in der Abflughalle und heulen wie die Schloßhunde, und die Kinder haben während des ganzen Fluges eine fürchterliche Laune.”
“Ich werd’s versuchen.” Ich nehme es mir wirklich vor. Aber dann, als wir uns alle ein letztes Mal umarmen, werden meine Augen feucht. Ich kann meine Tränen aber gerade noch unterdrücken.
“Tschüß Papa.” Ich verliere die Kontrolle, aber nur für ganz kurz. Und jetzt, da ich diese Zeilen schreibe, verliere ich sie wieder.
“Mach schnell, ich halt’s nicht mehr lange aus”, dränge ich meine Frau. Sie versteht und passiert mit den Kindern den Metalldetektor am Flughafen, ohne sich nochmal umzudrehen. Ich drehe mich um und gehe zurück Richtung Aufzug, gleichfalls ohne auch nur einmal zurückzuschauen.
Absprungvorbereitungen
Auf meinem Rückweg nach Hove versuche ich, mich auf die vor mir liegenden Aufgaben zu konzentrieren. Bereits im Juni 1999, während einer Vortragsreise durch die Vereinigten Staaten, habe ich Möglichkeiten ausgelotet, in die USA überzusiedeln. Da ich im Laufe des Jahres 1999 erkannt hatte, daß der Revisionismus nur dann Erfolg haben kann, wenn er in der Weltsprache Englisch präsentiert wird, war mein Entschluß gereift, dies von den USA aus zu versuchen. Da mich meine Familie nun verlassen hatte, gab es nichts mehr, was mich noch zwingend an England band. Jeder Winkel, jede Straße, ja sogar jedes Geschäft und jeder Supermarkt dort sind angefüllt mit schmerzlichen Erinnerungen an meine Familie. Zudem haben die USA diese göttliche Erfindung namens absolute Redefreiheit. Lag es da nicht nahe, den Weg ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten zu suchen?
Während meiner zweiten Reise in die USA Ende September 1999 gelang es mir dann tatsächlich, bei einem kleinen Verlag namens Theses & Dissertations Press, geleitet von Dr. Robert Countess, eine Stelle als Herausgeber angeboten zu bekommen. Schon damals stand also fest, daß ich in die USA gehen würde. Alles hing lediglich von den Einwanderungsformalitäten ab, die sich freilich über viele Monate oder gar Jahre hinziehen können.
Jetzt aber, da in England die Hetzjagd auf mich begonnen hat, sieht alles anders aus. Ich kann nicht mehr warten, bis ich ein Arbeitsvisum oder eine Greencard ausgehändigt bekomme. Ich würde vielmehr, so beschlossen Tony und ich eines Abends, einfach mit einem Besuchervisum einreisen. Alles weitere würde sich dann ergeben.
Kaum im Hause Hancock angekommen, teilt mir Corinne mit, ich solle umgehend nach Uckfield zur Druckerei fahren, um mit Tony alles weitere zu besprechen. Ich zögere keine Sekunde, drehe auf dem Absatz um und fahre nach Uckfield. Diesmal allerdings fahre ich nicht direkt zur Druckerei. Wer weiß, vielleicht wartet da ja schon jemand auf mich. Ich parke mein Auto also auf dem Parkplatz des Tesco-Supermarktes und gehe die Hauptstraße runter, anstatt in die Seitenstraße zur Druckerei einzubiegen. Ich versuche, von hinten über ein paar andere Grundstücke zur Druckerei zu kommen. Ich habe das niemals zuvor versucht und weiß gar nicht, ob es geht, aber ich habe Glück: all die Fabriken dort haben offene Toren und Türen in den Zäunen. Sicher ist sicher…
“Hi, Germar. Wie war’s in Heathrow?” begrüßt mich Tony.
“Es ging so. Wir haben es kurz und schmerzlos gemacht, wenigstens fast.”
“Graham hat seine Hilfe angeboten.”
“Oh, ist er da?”, frage ich Tony.
“Ja, bei der Arbeit. Aber es ist zu laut im Druckraum. Laß ihn seinen Job fertigmachen, und dann wird er zu Dir kommen und Dir Näheres mitteilen. Am besten wäre es, mit ihm in den Dunkelraum zu gehen. Da seid ihr ungestört und es ist ein wenig sicherer.”
“Danke. Ist Howard auch da?”
“Nein, er kommt erst morgen wieder.”
Graham Jones ist Tonys einziger professioneller Druckfachmann, das Juwel seiner Mannschaft, und der Einzige, der nicht irgendwie politisch aktiv ist bzw. war. Ich frage mich daher, was ihn dazu bewegt haben mag, mir seine Hilfe anzubieten. Wir machen es kurz. Er gibt mir seine Adresse in Henfield und seine Telefonnummer sowie eine Wegbeschreibung zu seinem Hause. Er meint, er sei ab etwa 18:00 Uhr abends Zuhause, weswegen ich nicht vorher dorthin kommen solle, da er dort alleine wohne. Er schlägt vor, daß ich erst einmal auf unbegrenzte Zeit in dem Zimmer eines seiner Söhne wohnen kann, der zur Zeit an der Universität ist. Ich erläutere ihm, daß ich meine gesamte Computerausrüstung mitbringen müßte, um in den nächsten Tagen meinen Geschäften nachgehen zu können.
“Bist Du damit einverstanden?” frage ich ihn.
“Wieviel Zeug ist denn das?”, erwidert er.
“Du hast wohl noch nie einen PC gesehen, oder?” ziehe ich ihn auf. “Es paßt alles auf einen mittelgroßen Schreibtisch. Es macht also keine weiteren Umstände. Ich bräuchte lediglich eine Telefonsteckdose in der Nähe oder eine entsprechend lange Verlängerungsschnur.”
Er ist damit einverstanden, obwohl ich ein paar Sorgenfalten in seinem Gesicht zu erkennen glaube, wohl aus der Befürchtung, ich könne ihm seinen Haushalt durcheinanderbringen.
“Keine Sorge”, versuche ich ihn zu beruhigen. “Ich arbeite ziemlich lautlos und ordentlich den ganzen Tag lang. Du wirst noch nicht einmal merken, daß ich da bin.”
“Gut. Du kannst erst einmal unbeschränkte Zeit bei mir wohnen, bis eine andere Lösung zur Hand ist.”
“Danke. Ich werde wahrscheinlich nicht länger als zwei oder drei Wochen bleiben, bevor ich mich ins Ausland abseile.”
“Ach ja, für die Wochenenden werden wir uns etwas anderes einfallen lassen müssen, da ich dann meine Mutter bei mir habe, und ich möchte nicht, daß sie Fragen stellt.”
“Gut. Fürs nächste Wochenende habe ich ohnehin schon etwas eingeplant gehabt.”
Ich verspreche ihm, am frühen Abend bei ihm Zuhause zu sein. Anschließend gehe ich zurück zu meinem Auto und fahre zu meiner Mietwohnung, um all jene Sachen zusammenzupacken, die ich in den nächsten Tagen brauchen werde: Kleidung, Nahrungsmittel, den Papierkram, den ich für meine Arbeit brauche, und natürlich meinen Rechner. Das alles dauert länger, als ich eingeplant hatte, und ich mache mich erst in der Dämmerung auf den Weg zu Grahams Haus. Auf dem Weg dorthin verfahre ich mich, aber beim zweiten Versuch klappt es dann, und gegen sieben Uhr abends trudle ich bei ihm ein. Graham hat mich schon erwartet. Er hilft mir, meine Sachen in das Zimmer seines Sohnes zu tragen.
Nachdem ich mich provisorisch eingerichtet habe, gehe ich zu Graham ins Wohnzimmer. Er ist sehr nett und schaltet sogar den Fernseher aus, als ich reinkomme. Das ist durchaus nicht normal, wenn man englische Haushalte besucht!
“Darf ich fragen, warum Du mir Deine Hilfe angeboten hast? Ich meine, immerhin kennst Du mich doch gar nicht, oder?” frage ich ganz direkt.
“Nun, ich habe Dich öfter in der Druckerei gesehen, und Du scheinst kein übler Kerl zu sein. Außerdem glaube ich nicht, daß Du den Ärger, den Du jetzt hast, verdient hast”, erklärt Graham.
“Bist Du irgendwie politisch engagiert?”, will ich wissen, neugierig wie ich bin.
“Nein, ich habe keinerlei politische Interessen oder Vorzüge.”
“Wie kommt es dann, daß Du in Tonys Druckerei arbeitest?”
Graham erzählt mir seine Geschichte, wie er seine alte Stellung verließ, wo man sein Fachwissen als professioneller Druckfachmann nicht zu würdigen wußte, und wie er sich für eine neue Stelle bewarb. Eine von mehreren Stellenangeboten, die er den regionalen Zeitungen entnahm, kam von Tony.
“Aber Tonys Druckerei ist doch ein Dritte-Welt-Firma mit einem total veralteten Maschinenpark, die in Dreck und Unordnung versinkt und in der totales organisatorisches Chaos herrscht. Wie kann man freiwillig dort arbeiten wollen?”
So harsch dieses Urteil auch scheint, es stammt von Tony selbst. Er selbst meinte einmal, er benötige alle paar Jahre einen Brandanschlag oder eine Überschwemmung, damit mal wieder ein Anlaß da sei auszumisten.
“Das stimmt schon,” erwidert Graham, “aber ich bin dort der einzige Fachmann, und ich kann daher meine eigenen Ideen umsetzen. Ich bin fast so etwas wie mein eigener Boß. Und was am wichtigsten ist: Ich kann hier mein Hobby voll umsetzen, nämlich Fisch-Poster drucken und vermarkten. Die Süßwasser-Fischerei ist nämlich mein Hobby, und Tony gibt mir freie Hand, um es umzusetzen.”
Jetzt ist es an mir, meine Geschichte zu erzählen, denke ich.
“Weißt Du eigentlich, warum ich all den Ärger habe?” frage ich Graham.
“Nicht genau, nein. Ich habe nur Bruchstücke aufgeschnappt. Tony hat mir mal erklärt, daß Wolfgang irgend etwas Deinem Gutachten hinzugefügt hat, ohne Dich darüber zu informieren.”
“Das stimmt. Jetzt, da Du mir Deine Hilfe angeboten hast, bist Du daran interessiert, mehr darüber zu hören? Du solltest immerhin wissen, warum auch Du nun Ärger bekommen könntest, jetzt, da Du einem Kriminellen beim Untertauchen hilfst,” erwidere ich mit einem breiten Grinsen im Gesicht.
Er ist in der Tat neugierig, und so verbringen wir die nächsten zwei Stunden damit, indem ich ihm meine Geschichte erzähle.
“Aber warum hast Du dem Gericht nicht die Wahrheit gesagt? Warum hast Du nicht gesagt, wer es war, wenn Du doch unschuldig warst?” fragt Graham mich etwas verständnislos.
“Du meinst, ich hätte den wahren ‘Täter’ verraten sollen? Es war sicher dumm von ihm, meinem Gutachten diese Zusätze hinzuzufügen. Aber objektiv betrachtet war dies nichts, für das irgend jemand eine Gefängnisstrafe verdient hätte.”
“Aber letztlich bist Du zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden.”
“Ja, aber ich war eben so naiv zu glauben, daß mich ein deutsches Gericht unmöglich für etwas verurteilen würde, woran ich so offenkundig keinen Anteil hatte. Ich nehme an, daß das Gericht ahnte, wer der wirkliche ‘Täter’ war, aber sie hatten keine Beweise gegen ihn. Bei meiner ersten Hausdurchsuchung im September 1993 hat die Staatsanwaltschaften viele Indizien gefunden, die auf den ‘Täter’ hinwiesen, der damals offenbar eine zentrale, aus dem verborgenen handelnde Rolle für den Revisionismus in Deutschland spielte, und es war klar, daß er damals ein enger Freund von mir war.
Im August 1994, parallel zum Besuch des israelischen Staatspräsidenten Herzog, startete das Bundeskriminalamt dann eine bundesweite Hausdurchsuchungsaktion gegen diese Zentralfigur. Diese zeitliche Parallele war offenbar kein Zufall. Man wollte dem israelischen Staatspräsidenten quasi seinen Kopf präsentieren. An acht Stellen, bei Verwandten und Bekannten, wurde alles auf den Kopf gestellt, einschließlich meiner Wohnung. Aber glücklicherweise wurden wir von einem Informanten innerhalb des BKA gewarnt, und so ging das BKA letztlich völlig leer aus. Man sieht also, daß wir hier und da mit Helfern und Freunden im System rechnen können.
Ich nehme an, daß der Schauprozeß gegen mich der letzte Versuch war, dieser damaligen geheimnisvollen Zentralfigur des deutschen Revisionismus habhaft zu werden. Mit der offenen Drohung, mich als unschuldigen Familienvater zweier Kleinkinder ins Gefängnis zu schicken, hoffte man vielleicht, daß entweder ich den wahren ‘Schuldigen’ präsentiere, oder daß dieser sich selbst stellt. Aber auch dieser Versuch ist gescheitert.
Man hätte den wahren ‘Täter’ wahrscheinlich zu der Höchststrafe von fünf Jahren verurteilt, denn die Verbreitung meines Gutachtens war ja nur einer unter vielen Punkten, die man ihm zu Last gelegt hätte. Wenn also überhaupt irgend jemand moralisch verpflichtet gewesen wäre, die Wahrheit zu sagen, so wäre es der ‘Täter’ selbst gewesen. Aber der hätte sich selbst massiv belasten müssen, und dazu kann ihn keiner zwingen. Aber wie dem auch sei, letztlich ist keiner von uns ins Gefängnis gegangen, und auch alle anderen, die in diese Aktion verwickelt waren, sind davongekommen. Und alle veröffentlichen und arbeiten sie ununterbrochen und ungehindert weiter im Revisionismus. Was soll’s also?
Obwohl ich natürlich nicht mit allem übereinstimme, was mein Freund so von sich gegeben hat – und ich war wirklich aufgebracht über seine unsachgemäßen Zusätze zu meinem Gutachten – so würde ich aber in Sachen Redefreiheit niemals jemanden verraten, so daß dieser deshalb ins Gefängnis kommt. So einfach ist das. Ich möchte ja auch nicht, daß mich jemand für das verrät und ausliefert, was ich gesagt oder geschrieben habe.”
Nachdem wir uns ausgesprochen haben, ist es Graham nun ganz offensichtlich wesentlich wohler zumute. Ich habe oft bemerkt, daß die Menschen in meiner Privatsphäre oft recht engagiert werden, wenn sie einmal ein wenig teilhaben dürfen an einer echten Kriminalgeschichte mit einer Prise Agententätigkeit und Verschwörung, wie in einem spannenden Film eben. Es ist offenbar positiv stimulierend, einmal einen kleinen Anteil an einer solch spannenden Geschichte zu haben, vorausgesetzt freilich, man bekommt dadurch nicht selbst zu viel Ärger…
In der folgenden Zeit versuche ich zu organisieren, was vor meiner Abreise noch auf die Schnelle organisiert werden muß: Wichtige Korrespondenz, Bestellungen abarbeiten, das Buch Riese auf tönernen Füßen sowie die Ausgabe 4/1999 von VffG zum Drucker bringen, und schließlich meine zweite Identität in meiner Heimatsiedlung auflösen. Michael Martin kam aus dem Nichts und verschwindet wieder im Nichts. Howard ist mir eine große Hilfe dabei. Er mietet für mich einen Kleinlaster, und wir beide transportieren all mein Hab und Gut nach Uckfield und lagern es vorübergehend in einem Container auf dem Grundstück von Tonys Druckerei. Dort bleibt es solange, bis ich Bescheid gebe, wohin es verschifft werden soll. Howard erklärt sich damit einverstanden, von mir als Versandmensch angestellt zu werden. Zudem erhält er Unterschriftsberechtigung zu meinem englischen Bankkonto, so daß er bei meiner Abwesenheit alle notwendigen geschäftlichen Dinge erledigen kann. Dies wird mir erlauben, über eine unbestimmte Zeit hinweg die Illusion aufrecht zu erhalten, ich sei nach wie vor in England – und zwar sowohl bei den Behörden als auch bei meinen Kunden. Das einzige wirklich Problem wird die Korrespondenz sein, die mir nachgesandt werden muß, was wohl Wochen in Anspruch nehmen wird.
Als Howard und ich zu meiner Bank gehen, begrüßt mich der Bankangestellte freundlich:
“Guten Tag, Mr. Scheerer! Wie können wir Ihnen heute helfen?”
Man fühlt sich gleich wie zu Hause, wenn einen die Leute beim Namen nennen und einen nicht ständig als Nazi beschimpfen. Ich werde das vermissen. Mein kleiner Lagerraum, den ich für Bücher angemietet habe, muß gleichfalls ausgeräumt werden. Ich hoffe bloß, daß der Verwalter des Lagers nichts von der Sunday Telegraph Affäre mitbekommen hat.
“Wie geht’s Dir, Germar?” begrüßt er mich freundlich. Das ist wie Balsam auf offene Wunden. Zumindest bin ich für ihn noch kein Monster. Ich stelle ihm also Howard vor als denjenigen, der meine Geschäfte in den nächsten Monaten abwickeln wird.
In der Zwischenzeit sagen meine Geschwister einen Besuch ab, den sie für das Wochenende nach meinem Geburtstag eingeplant hatten. Meine Frau hat sie inzwischen über den Schlamassel informiert, in dem ich mich gerade befinde. Ich bin etwas niedergeschlagen angesichts dieser Nachricht. Ich hätte etwas Zerstreuung durchaus brauchen können, aber wahrscheinlich haben sie recht. Nun müßte ich auch John absagen, der meinen Geschwistern seine Bed-and-Breakfast-Zimmer in Jevington zur verfügen stellen wollte. Good old John Ryder-Smith, über 70 Jahre alt, ist in den letzten Jahren ein enger Freund von uns geworden, insbesondere meiner Frau. Ich möchte ihn nicht mit meinen Problemen beunruhigen. Es war für ihn schon hart genug, daß mich meine Frau mit den Kindern verlassen hat. Ich erkläre John also, daß ich statt meiner Geschwister bei ihm übernachten werde, da meine Geschwister mein Doppelbett bevorzugen (was John wohl denken mag?). Auf diese Weise komme ich am Wochenende aus Grahams Haus heraus, und John macht sich keine Sorgen…
Schlagartig fällt mir ein, daß ich einen weiteren für das gleiche Wochenende angekündigten Besucher völlig vergessen habe. Marc Dufour, ein französischer Revisionist, will mich besuchen, um mit mir die Veröffentlichung eines Buches Die Lüge spricht zwanzig Sprachen zu besprechen, das er während der letzten Jahre verfaßt hat. Er hat mir die Rechte dazu angeboten. Soviel ich weiß, hat er bereits die Fahrkarte für den Kanaltunnel gekauft. Er wird sicher böse auf mich sein, wenn ich ihm absage. Ich rufe ihn von einem öffentlichen Telefon in Pevensey Bay an und beichte ihm, daß ich ihn unter keinen Umständen am kommenden Wochenende sehen kann. Er ist eingeschnappt, denn er hat bereits den teuren Fahrschein für die Zugfahrt durch den Tunnel gekauft. Leider kann ich ihm noch nicht einmal erklären, warum ich ihn nicht treffen kann, habe also keine Möglichkeit, seinen Zorn zu besänftigen.
Tony und Howard versprechen mir, mein Hab und Gut auf den Weg zu schicken, sobald ich ihnen mitgeteilt habe, wo ich mich aufhalte. Ich gebe Tony einen Scheck über 3.000 englische Pfund und bitte ihn, diesen Scheck erst einzureichen, nachdem ich das Land verlassen habe. Als Gegenleistung vereinbaren wir, daß Tony mir am Vorabend meiner Abreise 3.000 britische Pfund in bar übergibt. Auf diese Weise habe ich genug Bargeld für die Reise und löse bei meiner Bank keine Alarmglocken aus. Man weiß ja nie…
Als nächstes muß ich einen Weg finden, dieses Land unbemerkt zu verlassen. England, ich mag Dich wirklich, und eigentlich möchte ich gar nicht gehen. Aber anscheinend magst Du mich überhaupt nicht leiden. Du scheinst mich zu hassen. Ich habe verstanden, obwohl ich sicher bin, daß Du Deine Ansicht ändertest, wenn Du mir nur zuhören würdest. Ich bekomme schon beim bloßen Gedanken, England zu verlassen, Heimweh.
Es ist zu gefährlich, das Land per Flugzeug zu verlassen. Als ich England im Juni 1999 für eine zweiwöchige Tour durch die USA verließ, kontrollierte ein Sicherheitsbeamter am Flughafen Heathrow meinen Paß und stutzte:
“Sind Sie deutscher Staatsangehöriger?” frug er mich.
“Ja, warum?”
“Warum beginnen Sie Ihre Reise dann hier in London?”
“Weil ich hier in England wohne.”
“Wo wohnen Sie denn?” hakte er nach.
“In East Dean.”
“Haben Sie irgendwelche britische Ausweispapiere?”
“Ähhh – ich habe nur meinen Sozialversicherungsausweis.”
“Das geht in Ordnung. Kann ich den sehen.”
Ich gab ihm den Ausweis, und mit Paß und Ausweis versehen verließ der Beamte die Schalterhalle durch eine Hintertür. Minuten vergingen. Mein Herz schlug merklich schneller, und ich fing zu schwitzen an. Dies war das erste Mal seit meiner Flucht aus Deutschland, daß ich einer Paßkontrolle unterzogen wurde. Was würde geschehen? Und ich Idiot sagte ihm auch noch, ich wohnte in East Dean. Mein englischer Sozialversicherungsausweis ist allerdings auf Hastings ausgestellt, auf Howards Wohnung. Oh, Junge! Das konnte Ärger geben!
Der Beamte kam schließlich zurück und gab mir Paß und Ausweis mit der knappen Bemerkung zurück, es sei alles in Ordnung.
Welch eine Erleichterung!
Mich an diese ängstigenden Minuten erinnernd, ist mir klar, daß ein einziger Eintrag in irgendeiner Sicherheits-Datenbank am Flughafen dazu führen kann, daß die ganze Geschichte bei der nächsten Kontrolle weniger glimpflich ausgeht. Zudem muß ich den britischen Behörden ja keine offensichtliche Spur hinterlassen, indem mein Name als Passagier eines Fluges von London in die USA feierlich auf allerlei englischen Computern abgelegt wird. Es ist also ratsam, England nicht von einem Flughafen aus zu verlassen. Es ist aber auch keine Alternative, den Ärmelkanal zu überqueren, denn die Paßkontrollen sind dort relative streng. Die einzige Option ist daher Irland. Unabhängiges Südirland. Es sollte kein großes Problem sein, das Irische Meer mit einer Fähre zu überqueren, zumal Südirland im Gegensatz zu Nordirland ja keine Sicherheitsprobleme hat. Ich hoffe daher, daß die Paßkontrollen auf der Fähre recht lasch sind. Graham teilt mir mit, daß es sogar Zugfahrkarten gibt, die das Fährticket gleich mit beinhalten. Als nächstes fahre ich also zum nächst größeren Bahnhof, um herauszufinden, was so eine Fahrkarte kostet. Es stellt sich heraus, daß man bei Kauf einer solchen Karte seinen Namen und seine Adresse angeben muß. Allerdings bedarf es keines Ausweises. Ich kaufe also eine solche Fahrkarte nach Dublin für das Wochenende des 13. November auf meinen “zweiten” falschen Namen. Das klappt ja wie am Schnürchen.
Anschließend mache ich meine Mietwohnung übergabebereit, so daß Howard beim Auslaufen des Mietvertrages im Januar 2001 nur noch wenig Arbeit haben wird. Nach getaner Arbeit verlasse ich meine liebgewonnene Siedlung zum letzten Mal. Die Sonne steht tief am Horizont und scheint in wunderbarem Gold über die Weiden der Seven Sisters. Sogar die Schafe sind aus purem Gold. Ich mag gar nicht gehen. Ist das nicht vielleicht doch nur ein Alptraum? Kann mich denn niemand aufwecken?
Am Parkplatz beim Viehgitter halte ich an, steige aus meinem Auto aus und setze mich auf eine Bank, um ein letztes Mal den Sonnenuntergang daheim zu erleben. Ich werde fürchterliches Heimweh bekommen. Schau es Dir genau an. Präge Dir dieses farbenprächtige Bild ein! Dies ist das letzte Mal, daß Du es zu Gesicht bekommst.[6]
Dies wird Dein Seelenfutter sein für die vielen kargen Jahre in der Fremde, die womöglich nun vor Dir liegen…
Es ist Donnerstag Abend. Mein Zug fährt am Samstag. Ich entschließe mich, den Abend im mittelalterlichen Tiger Inn in East Dean zu verbringen, meiner Lieblingsgaststätte. Während ich an der Bar stehe und auf meine Bestellung warte, bemerke ich ein junges Paar mit einer Dame mittleren Alters. Die beiden Damen sprechen mit schwerem deutschen Akzent mit dem jungen Mann, miteinander jedoch sprechen die Damen deutsch. Welch eine wunderbare Gelegenheit zu meinem Lieblingsspiel! Ich gehe auf ihren Tisch zu, schon allein, um nicht völlig alleine zu sein. Ich fange eine Konversation auf Englisch an. Der junge Mann ist offenbar Engländer, aber die beiden Damen sind Deutsche. Sie bemerken aber nicht, daß ich Deutscher bin. Der Engländer bemerkt zwar meinen Akzent, kann ihn aber nicht einordnen, und das, obwohl er mit einer Deutschen verlobt ist. Ich lasse sie alle raten, was meine Muttersprache ist. Ich liebe dieses Spiel, denn es errät fast niemand mehr auf Anhieb, und auch nicht beim zweiten oder dritten Anlauf, daß ich Deutscher bin. Als ich es schließlich preisgebe, sind die beiden Damen sehr überrascht. Ob ich denn die ganze Zeit verstanden hätte, was sie geheimnisvoll miteinander besprochen hätten. Das ist ja der Spaß am Ganzen! In der Schule habe ich Englisch mit einer 5 abgeschlossen. Und nun erkennt man kaum mehr meinen Akzent. Wenigstens eine kleine Genugtuung! Der Abend ist erfolgreich in dem Sinne, daß er mich völlig von meinen Sorgen und Nöten ablenkt.
Am nächsten Tag arbeite ich die restlichen bürokratischen Kleinigkeiten ab und packe meine sieben Sachen. Am Abend, als ich die letzten Dinge zusammenkrame, bemerke ich, daß mein Paß nicht dort ist, wo ich glaube, ihn zuletzt hingelegt zu haben. Ich werde nervös. Wo ist mein Paß? Die Nervosität steigert sich zusehends. Ich öffne alle Kartons und Pakete wieder, die ich gerade erst zugeklebt habe. Ich durchsuche alles, drehe jeden Papierstapel zweimal um. Nichts. Er ist verschwunden.
Als Graham von der Arbeit zurückkommt, berichte ich ihm von diesem Malheur. Er ruft Tony an, um das für diesen Abend arrangierte Treffen zur Übergabe der £3.000 zu streichen. Anschließend durchsuchen wir zusammen noch einmal all meine Unterlagen und gehen alle meine Handlungen und Aufenthaltsorte der letzten Tage durch.
Am Samstag Morgen, dem Tag meiner geplanten Abfahrt, fahre ich zu Tonys Haus und berichte ihm vom verlorenen Paß. Wir suchen sein Haus ab. Vielleicht habe ich den Paß ja dort liegen lassen. Aber wir finden nichts.
Ich fahre in meine leere Mietwohnung, aber auch dort ist nichts zu finden.
Habe ich den Paß in jener stürmischen Nacht verloren, als ich über die Weiden von hinten zu meiner Wohnung ging? Nein, daß kann nicht sein, da ich mich definitiv erinnere, ihn in Grahams Wohnung abgelegt zu haben. Oder liegt er vielleicht bei John, wo ich am vorigen Wochenende übernachtete? Aber auch dort ist nichts zu finden.
Verlor ich ihn am Donnerstag Abend im Tiger Inn, als ich meine Windjacke achtlos auf den Stapel mit den anderen Jacken warf? Oder habe ich ihn vorgestern im Beachy Head Restaurant verloren? Alle Nachfragen an diesen Orten ergeben nichts. Wo ist dieses verdammt Ding?
Tom Acton, der vierte Mann in Tonys Druckerei, versucht mich an diesem Wochenende etwas aufzumuntern. Da ich am Wochenende ja nicht bei Graham schlafen kann, läßt mich Tom am Samstag und Sonntag bei sich in Brighton wohnen. Er nimmt mich zu einem ausgedehnten Spaziergang um den Devil’s Dyke nördlich von Brighton mit. Außerdem gehen wir zusammen Badminton spielen. Er schlägt mich. Ich habe seit 10 Jahren nicht mehr gespielt, und es ist daher kein Wunder, daß ich mit ihm nicht mithalten kann. Tom meint, er trainiere insgeheim, weil ihn Tony schon seit einigen Monaten einlädt, seiner Badminton-Gruppe beizutreten, aber er will sich nicht blamieren und trainiert deswegen, um sie dann mit einer grandiosen Leistung zu beeindrucken. Das wird Dir zweifellos gelingen, Tom! Ich hatte vor drei Jahren nicht die geringsten Probleme, Tony und seine Freunde zu schlagen, selbst in der schlechten Form, in der ich damals schon war. Du wirst sie daher alle besiegen!
Während wir weiterhin nach meinem Paß suchen, entschließe ich mich, bei der deutschen Botschaft in London einen neuen ausgestellt zu bekommen. Ich sammle daher alle notwendigen Informationen. Es stellt sich heraus, daß man einen provisorischen Paß schon in ein paar Tagen bekommen kann. Die Ausstellung eines richtigen Passes benötigt aber etwa 6 Wochen, aber er kann als Einschreiben an eine Postadresse gesandt werden. Das ist gut, denn ich möchte doch verhindern, zweimal in die Höhle des Löwen gehen zu müssen. Am Montag lasse ich zunächst einen Satz Paßbilder von mir machen. Seit fast zwei Wochen habe ich mich schon nicht mehr rasiert. Nach über drei Jahren in England hat mein Elektrorasierer immer noch einen deutschen Stecker, und mein Adapter ist gut verstaut in irgendeinem Karton. Da kann man nichts machen. Die Paßbilder sehen dann auch erwartungsgemäß schrecklich aus. Ich muß aber wohl gestehen, daß sie mir irgendwie ähnlich sehen müssen.
Anschließend geht es von Brighton aus per Bahn nach London Victoria, und von dort bahne ich mir meinen Weg durch Londons U-Bahn-System zur deutschen Botschaft. Ich betrete das Gebäude mit einem ungeheuer flauen Gefühl in der Magengegend. Es ist kaum jemand im Wartesaal, und so erhalte ich die auszufüllenden Formulare schon nach wenigen Minuten. Jetzt kommt es darauf an. Ich händige der Dame am Schalter meine Unterlagen aus, und Sie fängt an, meine Daten in den Computer einzutippen.
Mal sehen, was passiert.
Sie zögert und schaut sich irgend etwas näher am Bildschirm an. Dann legt sie meinen Antrag zur Seite und kommt zum Schalter zurück:
“Würden Sie bitte einen Augenblick lang Platz nehmen, Herr Scheerer?”
“Warum? Stimmt was nicht?”
“Es gibt da ein Problem. Ich muß erst meinen Chef fragen. Bitte setzen Sie sich dort einen Moment hin”
Ich rieche eine Falle. Die Dame steht da und wartet, daß ich mich endlich setze. Also tue ich ihr den Gefallen und setze mich. Kaum daß ich sitze, verläßt sie den Schalterraum durch eine Hintertür. Und kaum daß sie den Schalterraum verlassen hat, springe ich auf und verlasse die Botschaft in zügigem Schritt. Du betrittst besser keinen deutschen Boden mehr, noch nicht einmal eine deutsche Botschaft! Die haben Dich ganz offenbar in ihrer Datenbank entsprechend vermerkt!
Draußen angekommen, mache ich mich im Eilschritt auf den Weg zum nächsten U-Bahn-Eingang. Als ich eine Straße einen Block hinter der deutschen Botschaft überqueren will, stoppt plötzlich ein großes schwarzes Auto vor mir und versperrt mir den Weg. Mein Herz bliebt fast stehen.
“Können Sie mir sagen, wo der Wilton Crescent ist?” fragt mich der Fahrer. Gott sei Dank nur eine dumme Frage! Nein, ich kann ihm nicht helfen, und selbst wenn ich es könnte, so würde ich mir bestimmt jetzt keine Zeit für ausführliche Wegbeschreibungen nehmen. Noch um zwei Ecken herum, und Londons Untergrund verschluckt mich wieder. Auf und davon.
Sobald ich zurück in Brighton bin, gehe ich zur nächsten öffentlichen Telefonzelle und rufe die deutsche Botschaft an. Man verbindet mich mit der Dame, die mich zuvor bedient hat. Ich entschuldige mich dafür, daß ich nicht warten konnte, und frage sie, ob sie inzwischen herausgefunden hat, wo das Problem liegt.
“Es liegt ein Paßverweigerungsgrund gegen Sie vor” erklärt sie.
Mich unwissend stellend, frage ich: “Was heißt das denn?”
“Das heißt, daß wir ihnen keinen neuen Paß ausstellen dürfen.”
“Und warum nicht, wenn ich fragen darf?”
“Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Unser Datensatz enthält keine Informationen über den Grund.”
Sie ist womöglich sogar aufrichtig und sie weiß wirklich nicht, was gegen mich vorliegt. Nun, ich selbst weiß es natürlich, aber ich verkneife es mir, ihr irgend etwas zu erzählen. Ich lege also auf, trotte etwas deprimiert zu meinem Auto zurück und fahre zurück zu Grahams Haus.
Was könnte ich sonst noch unternehmen? Vielleicht muß ich England ja gar nicht verlassen? Vielleicht können mich die britischen Behörden aus juristischen Gründen gar nicht ausliefern? Wie wäre es also, wenn ich zur Abwechslung mal juristischen Rat einhole? Schon in den Anfangszeit meines Aufenthalts in England habe ich Kontakt zu einem Anwalt aufgenommen, der in derartigen Fällen Erfahrung hat. Er kennt meinen Fall und hat womöglich sogar in den Medien verfolgt, was gegen mich im Gange ist. Ich fahre also nach Hove zu einem öffentlichen Telefon und rufe ihn an. Wie sich herausstellt, hat er die Medienkampagne gegen mich tatsächlich verfolgt und ist voll im Bild, was sich ereignet.
“Was meinen Sie also, was höchstwahrscheinlich passieren wird, wenn man mich findet?” frage ich ihn.
“Die europäischen Auslieferungsgesetze haben sich in den letzten Jahren massiv geändert. Soweit ich es verstanden habe, wurden Sie in Deutschland für ein Vergehen verurteilt, das formell gesehen auch hier in Großbritannien ein Vergehen darstellt mit einer ähnlichen Strafandrohung. Unter diesen Umständen werden EU-Bürger sofort ausgeliefert, und zwar ohne das Recht auf eine juristische Anhörung.”
“Aber das Vergehen, das ich angeblich begangen habe, würde in England doch noch nicht einmal zu einem Ermittlungsverfahren führen, von einer Verurteilung ganz zu schweigen” erwidere ich.
“Das ist sicher richtig, aber Sie werden keinen einzigen englischen Richter dazu bringen, sich Ihren Fall anzuhören. Ihr Fall wird auf einer reinen Verwaltungsebene behandelt werden. Die Justiz spielt darin gar keine Rolle. Ich sehe es daher als 99,9% sicher an, daß Ihnen niemand bei dem zuhören wird, was Sie zu sagen haben. Sie haben einfach kein Recht auf eine juristische Anhörung.”
“Es gibt also keinerlei Hoffnung?”
“Leider nein.”
“Danke schön für diesen Rat.”
Ist dies das Ende vom Lied?
Inzwischen suchen alle fieberhaft nach meinem Paß, aber ohne Ergebnis. Graham fragt sogar bei den örtlichen Polizeidienststellen an, ob dort irgendwelche deutschen Ausweispapiere gefunden wurden. Aber auch dort ist das Ergebnis gleich Null. Es hätte mich auch zu Tode erschrocken, sollte die Antwort der Polizei positiv gewesen sein. Das hätte immerhin die perfekte Falle sein können.
Nun heißt es also umplanen. Ohne Paß kann ich nicht in die Staaten reisen, aber der mir verbliebene Personalausweis gibt mir wenigstens noch Reisefreiheit innerhalb Europas. Ich bitte Howard daher, meine abgelaufene Fahrkarte nach Dublin in nächster Zeit zurückzugeben und zu versuchen, sie wenigstens teilweise erstattet zu bekommen. Zudem gebe ich meinen englischen Freunden nun meine geänderten Pläne bekannt: Ich werde das Land in Richtung Irland verlassen und mich dort für die nächsten Jahre unter einer neuen Identität verstecken. Ein Freund von mir wohnt dort nahe Killaloe nordöstlich von Limerick und erklärt sich spontan bereit, mich unterzubringen und beim Aufbau einer neuen Identität zu helfen.
Aufgrund der durch diesen Aufstand hervorgerufenen Verzögerung komme ich immerhin noch in die Lage, die Druckfahnen des Buches Riese auf tönernen Füßen, die am Mittwoch vom Drucker kommen, Korrekturlesen zu können. Was für ein Glück im Unglück: Die Seitenzahlen im Inhaltsverzeichnis sind völlig durcheinandergewürfelt. Was für ein Desaster wäre das gewesen, hätte ich es nicht noch in letzter Stunde korrigieren können…
Am Donnerstag erledige ich dann die letzte Korrespondenz und fange wieder einmal an, alles einzupacken, diesmal für eine Reise mit meinem kleinen Renault Clio auf einer anderen Fähre über das Irische Meer. Tony bekommt Bescheid, daß ich ihn am Freitag Abend treffen möchte, um die 3.000 Pfund zu erhalten. Und während ich so meine sieben Sachen packe, klappe ich auch einen kleinen Karton auf, den ich mir für jene Sachen zurückgelegt habe, die in letzter Sekunde einzupacken sind. Die in den letzten Tagen bearbeiteten Briefe und Dokumente werde ich in diesem Karton ablegen.
Ich traue meinen Augen nicht: In diesem Karton liegt mein Paß obenauf und grinst mir frech ins Gesicht! Halleluja! Aber dann greife ich mir an den Kopf. Warum habe ich nie in diesem Karton nachgeschaut? Und wieso zum Teufel habe ich meinen Paß in diesen Karton gelegt, der doch dazu bestimmt ist, mit all meinem anderen Hab und Gut im Frachtcontainer auf die Überführung zu warten? Meinen Paß muß ich aber doch immer bei mir haben. Germar, Du bist ein selten dämliches Riesenrindvieh! Meine Unfähigkeit zu suchen war ja schon immer legendär.
Als Graham nach Hause kommt, berichte ich ihm sofort die frohe Botschaft, ermahne ihn aber zugleich, es niemandem zu sagen. Denn falls es irgendwo im System ein Leck gibt, so wird die in den letzten zehn Tagen verbreitete Desinformation Gold wert sein.
“Das ist genial! Hast Du das von Anfang an so geplant? War das alles eine Show, was Du hier abgezogen hast?” fragt er mich völlig überwältigt.
“Nein, nein, das war leider alles echt. Ich war wirklich am Ende mit meinen Nerven. Ich weiß wirklich nicht, warum ich meinen Paß zu den Bürosachen gepackt habe. Aber wie dem auch sei. Das ganze Theater kommt uns jetzt sehr gelegen, denn jetzt glaubt jeder, daß ich meinen Paß verloren habe. Ich habe das sogar David Irving per Email mitgeteilt. Ich bin mir ziemlich sicher, daß sich diese schlechte Nachricht mittlerweile weiter verbreitet hat. Und sogar die deutschen Behörden glauben nun, daß ich in England in einer Falle sitze. Laß sie das ruhig alle weiter glauben!”
“Das ist perfekt!” meint Graham.
Ins Land der unbegrenzten Unmöglichkeiten
Am Tag darauf besorge ich mir ein zweites Mal ein Zugticket nach Dublin. Diesmal hält mich nichts mehr auf! (Hoffentlich…)
Gegen 8 Uhr abends treffe ich Tony vor einem italienischen Restaurant in Hove. Er überreicht mir das Geld und lädt mich zu einem letzten Abendessen in England ein. Fast drei Stunden lang sitzen wir zusammen und plaudern über alles Mögliche, und natürlich über meine Pläne, eine neue Existenz in Irland aufzubauen. Er muß ja auch nicht wissen, daß ich meinen Paß wieder gefunden habe. Also lasse ich auch ihn in seinem Glauben.
Was wäre ich ohne solche Freunde?
Mein Zug fährt am frühen Samstag Morgen ab, dem 20. November 1999. Noch vor der Morgendämmerung verlasse ich Grahams Haus. Ich wähle einen Umweg durch Alfriston, Litlington und East Dean, um von meiner geliebten Heimat ein letztes Mal Abschied zu nehmen. Ein letztes Mal werfe ich einen Blick auf die langsam in der Dämmerung erwachende Natur. Ich parke mein Auto in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof von Eastbourne. Howard hat versprochen, sich des Autos anzunehmen und es dem örtlichen Renault-Händler zu verkaufen. Mit sieben Jahren, 130.000 km und dem Lenkrad auf der “falschen” Seite wird er dafür wohl kein Geld bekommen.
Meine Zugreise zum Fährhafen in Pembroke über London ist absolut entspannend, verglichen mit den letzten drei Wochen. Während der Zug Eastbourne verläßt, summe ich ein Lied der Carpenters, das mir sehr gefällt:
“I beg your pardon. I never promised you a rose garden. Along with the sunshine, there’s gonna be a little rain sometimes.”
So ist das Leben!
Im Fährhafen muß ich mein Reisegepäck, das aus nur einer Reisetasche besteht, einem Hafenarbeiter übergeben und in einen Bus einsteigen. Das macht mich schon etwas nervös. Macht keine Fehler, Jungs! Diese Tasche ist alles, was ich besitze! Ich hoffe zudem, daß ich im richtigen Bus sitze, der in die richtige Fähre einfährt.
Im Innern der Fähre sagt man uns dann, daß wir uns um unser Gepäck nicht zu kümmern brauchen, da es im Gepäckabteil des Busses bleibt. Wir würden es nach der Ankunft in Dublin ausgehändigt bekommen. Wie kommt es bloß, daß mich das alles nervös macht?
So selbstverständlich es auch ist, daß es beim Verlassen Großbritanniens keine Ausweiskontrollen gibt, es beruhigt mich doch ungemein, keine englischen Uniformierten zu sehen. Die Reise verläuft ruhig, ja geradezu langweilig. Aber wer wollte sich beschweren. Ein kurzer Flirt mit einer der jungen Damen im Delikatessenladen ist das aufregendste, was diese Fähre zu bieten hat. Die Filme im Kino interessieren mich überhaupt nicht, und zum Schlafen bin ich auch nicht müde genug. So vertreibe ich mir halt die Zeit damit, endlos in die Irische See zu starren und meine Gedanken treiben zu lassen: Zuerst die entschwindende heimatliche britische Küste, und dann, nach etwa zwei Stunden, die sich nähernde irische Küste.
Bei der Ankunft in Irland verhält es sich freilich etwas anders in Sachen Ausweiskontrolle, aber mehr als ein flüchtiger Blick in meinen Paß erfolgt auch hier nicht. Keine Scanner oder Computer weit und breit in Sicht. Das ist eben der Unterschied zwischen einem Flughafen und einem Fährhafen. Ich mag das!
“Wo kommen Sie her?” fragt mich einer der irischen Beamten. Er erwischt mich auf dem falschen Bein.
“Aus England, natürlich. Ich meine, die ganze Fähre kommt doch aus England, oder?”
Was für eine blöde Frage war denn das? Vielleicht wollte er ja wissen, wo ich wohne, aber meine Antwort auf diese Frage hätte genauso gelautet. Wie dem auch sei, den Beamten kümmert es nicht, und er läßt mich anstandslos passieren. Es dauert ein paar Minuten, bis ich mein Gepäck ausgehändigt bekomme, und einige weitere, bis ich herausgefunden habe, wo denn ein Bus nach Dublin abfährt. Wie sich herausstellt, ist der Fährhafen recht weit südlich von Dublin gelegen, der Flughafen aber liegt nördlich der Stadt. Ich muß folglich in der Stadtmitte umsteigen. Als ich endlich im Flughafen ankomme, ist es schon nach 18:00 Uhr, und keine der Fluggesellschaften, die Flüge in die Staaten anbieten, hat mehr offen. Eine Putzfrau sagt mir, ich müsse am nächsten Morgen wiederkommen, so gegen 8 Uhr. Ich bin enttäuscht. Eigentlich wollte ich so schnell wie möglich aus Europa verschwinden. Aber da ja niemand weiß, daß ich hier bin, ist es eigentlich auch egal.
Ich frage einen Taxifahrer nach einer günstigen Übernachtungsmöglichkeit, und der nimmt die Gelegenheit beim Schopfe, um mich zurück zur Innenstadt zu fahren, wo seiner Erfahrung nach die billigsten Unterkünfte zu finden sind. Während der halbstündigen Fahrt entwickelt sich ein nettes Gespräch über die Engländer, die Iren und die Deutschen und deren Beziehungen zueinander.
Es stellt sich heraus, daß der Taxifahrer mich bei einer Art Jugendherberge abgeliefert hat. Dort muß ich meinen Ausweis als Sicherheit hinterlegen, und der Angestellte an der Rezeption trägt alle möglichen persönlichen Daten in seinen Computer ein. Muß das sein, das hier wieder mal alle möglichen Spuren gelegt werden? Nun ja, es ist wohl unwahrscheinlich, daß diese billige Absteige einen direkten heißen Draht nach London oder gar Berlin hat, also was soll’s.
Nachdem ich ein wenig von meiner Futterration zu mir genommen habe, mache ich einen Bummel durch Dublins Innenstadt. Da wir uns schon auf Weihnachten zu bewegen, erstrahlt die Stadt im auch hier üblichen Weihnachtsschmuck. Allerdings bin ich etwas enttäuscht über diese Stadt. Ich hatte sie mir etwas fußgänger- und touristenfreundlicher vorgestellt. Aber zumal ich hier ja nicht bleiben will, kann’s mir auch egal sein…
Geschlafen wird in einem großen Schlafraum mit zehn anderen Kerlen zusammen. Um 5:30 ist für mich die Nacht allerdings schon zu Ende. Nach einer warmen Dusche und einem hastigen Frühstück geht es dann per Taxi zurück zum Flughafen. Ich bin allerdings zu früh und muß etwa eine Stunde warten, bevor die Schalter der Fluggesellschaften aufmachen. Es ist gar nicht so einfach, an diesem Sonntag für den gleichen Tag ein Flugticket in die Staaten zu bekommen, aber nach ein bißchen hin und her, und um 1.000 irische Pfund ärmer, gelingt es schließlich. Flugziel: Huntsville, Alabama, via New York. Geradewegs zu Robert Countess. Er hat mich für seinen Verlag angeheuert, und nun wird er mit der Tatsache leben müssen, daß ich frühzeitig und völlig unangemeldet bei ihm hereinschneie.
Allerdings geht es zunächst auf einen Umweg. Der Flug geht über Shannon in Südwest-Irland. Dort müssen alle Passagiere, die weiter nach New York fliegen, das Flugzeug verlassen und durch die Einwanderungskontrolle der US-Behörden gehen. Es ist mir neu, daß die US-Behörden diese Formalitäten bereits auf ausländischem Boden erledigen, aber mir soll das recht sein. Vielleicht ist dies sogar ein großer Vorteil für mich. Denn für den Fall der Fälle, daß man mich abweisen sollte, strande ich ganz einfach in Irland. Das wäre ohnehin das Land meiner zweiten Wahl gewesen. Würde ich in den USA abgewiesen werden, würde man mich womöglich sogar verhaften und in einen Flieger nach England oder Deutschland zurücksenden und die dortigen Behörden auch noch einweihen. Von daher kann mir eigentlich nichts Besseres passieren.
Als EU-Staatsbürger muß man für Urlaubs- und Geschäftsreisen in die USA Gott sei Dank kein Visum haben, sondern vor der Paßkontrolle nur ein kleines grünes Formular ausfüllen und Fragen des Stils “Waren Sie Mitglied in einer Nazi-Organisation” oder “Sind Sie zu zwei Gefängnisstrafen von zusammen mehr als zwei Jahren Haft verurteilt worden” beantworten (knapp drunter, Leute!).
Freilich weiß ich, daß dieser sogenannte Visa-Waiver kein Weg ist, um in die Staaten einzuwandern oder auch nur, um dort temporär zu arbeiten. Mit Robert Countess hatte ich diesbezüglich schon einen heftigen Streit. Schon Anfang Oktober hatte dieser eine Einwanderungsanwältin ausfindig gemacht, die sich um meine Einreise kümmern sollte. Und diese Dame habe, so Countess, steif und fest behauptet, ich könne mit einem Visa-Waiver kommen und mein Status könne dann hier angepaßt werden. Ich habe ihm kein Wort geglaubt, denn auf dem Visa-Waiver steht explizit, daß diese zeitlich beschränkte Aufenthaltserlaubnis nicht zur Aufnahme irgendwelcher Erwerbstätigkeiten berechtigt und auch nicht in eine andere umgeändert werden kann. Aber Dr. Countess bestand darauf, daß eine solche Anpassung möglich sei, da dies zweimal von besagter Anwältin bestätigt worden sei. Aber wie dem auch sei, ich habe nun keine Wahl mehr, und wenn sich später herausstellen sollte, daß mein Aufenthaltsstatus nicht angepaßt werden kann, so werden wir eben eine andere Lösung finden müssen.
Der US-Grenzbeamte sieht mich an und fragt mich nach meinem Flugticket.
“Sie haben ja nur einen Hinflug. Mit einem einfachen Flug können wir Ihnen die Einreise nicht genehmigen. Sie müssen schon ein Rückflugticket vorzeigen.”
Sch…e. Was soll ich denn darauf antworten?
“Ja, aber ich weiß noch nicht, wann ich zurückkehren werde. Deshalb habe ich erst einmal nur einen einfachen Flug gebucht.” Erkläre ich ihm.
“Was ist denn der Zweck Ihrer Reise?” fragt er.
“Ich bin dabei, mit meinem Verlag in den US-Markt zu expandieren, und will deshalb so eine Art Zweigstelle in den USA eröffnen. Das braucht einige Zeit, und ich werde eine Menge herumreisen.”
Er mustert mich von oben bis unten, schaut sich mein unrasiertes Gesicht an und meine lässige Reisekleidung und scheint mir nicht so recht zu glauben. Nun ja, zugegebenermaßen, ich sehe nicht gerade wie ein Geschäftsmann aus, der sein Unternehmen auf Weltmaßstab expandierten will. Aber das ist ja genau das, was ich vorhabe und weshalb ich mit Robert Countess dieses Geschäftsabkommen geschlossen habe. Und schließlich will ich wirklich irgendwann zurück nach Englands Sonnenscheinküste, wenn man mich nur läßt…
Der Grenzbeamte murmelt etwas vor sich hin, macht seinen Stempel in meinen Paß, und meint beiläufig: “Das nächste Mal besorgen Sie sich besser ein Rückflugticket.”
Nun, ich mag Rückflugtickets, aber die haben für mich den Haken, daß sie eben nicht funktionieren. Es wären für mich leider Tickets ohne Wiederkehr…
Und das war’s. Hurra! Ich bin durch!
Der Flug nach New York ist so langweilig wie alle Flüge, und in New York muß ich mehrere Stunden auf meinen Anschlußflug nach Huntsville warten. Dort komme ich gegen 9 Uhr abends an. Bob Countess ist zu dieser für ihn fortgeschrittenen Zeit bestimmt schon im Bett, und so versuche ich erst gar nicht, ihn anzurufen. Statt dessen rufe ich Craig Cox an, einen Freund von Bob, den ich bei meinen letzten zwei Kurzbesuchen im Juni und September kurz besucht habe. Er und seine Frau Patricia sind um diese Zeit bestimmt noch auf. Allerdings geht keiner ans Telefon. Erst beim dritten Anlauf klappt es dann.
“Hallo?”
“Hi Craig, ich bin’s, Germar”
“Oh! Wie geht’s Dir denn?”
“Danke, gut. Horch, ich bin hier in Huntsville am Flughafen.”
“Oh, wirklich? Du hast es also geschafft, aus dem belagerten Europa herauszukommen, wie? Ich wußte gar nicht, daß Du kommen würdest!”
“Ja, ich bin raus. Und daß es keiner weiß, ist ja genau der Sinn des ganzen Spiels. Ob ich wohl heute Nacht bei Dir übernachten darf?”
“Klar. Mein Haus soll auch Dein Haus sein. Weiß Bob, daß Du hier bist?”
“Nein. Keiner weiß es. Du bist der erste, dem ich es sage. Weißt Du, ich wollte Bob so spät nicht mehr belästigen, weil er bestimmt schon schläft. Deswegen habe ich sofort Dich angerufen. Kommst Du mich abholen, bitte?”
“Das geht schon in Ordnung. Du bist hier wirklich willkommen. Du kannst sogar länger bei uns bleiben, wenn Du willst. Ich werde in etwa einer halben Stunde am Flughafen sein.”
“Danke. Und sag bitte noch niemandem etwas, ja?”
“Klar. Bis gleich.”
“Bis gleich.”
Nach einer halben Stunde ist Craig dann tatsächlich da, und wir fahren zu seinem Haus. Patricia heißt mich auf ihre herzliche Weise willkommen, so daß ich mich wirklich wie daheim fühle. Ich habe die Familie Cox erst zweimal relativ kurz gesehen, aber das hat ausgereicht, um daraus eine wahre und zuverlässige Freundschaft werden zu lassen. Schön zu wissen, daß ich mich auf sie verlassen kann.
Am nächsten Morgen ruft Craig Bob an und teilt ihm mit, daß hier eine große Überraschung auf ihn warte, weshalb er doch bitte so schnell wie möglich vorbeikommen möge. Er sagt Bob nicht, was es ist, das er hier abholen soll, obwohl Bob ihn recht massiv bedrängt.
Einige Stunden später erscheint Bob dann in seinem neuen VW Käfer, und die Überraschung steht ihm wahrlich ins Gesicht geschrieben, als er mich erblickt. Auf unserm Weg zu seinem Haus erzähle ich ihm dann von meiner Odyssee. Bei ihm angekommen, frage ich ihn sogleich, ob ich Linda Faith in Cincinnati anrufen darf, die ich im September bei Irvings Real History Konferenz kennenlernte. Freilich darf ich, sagt er. Ich bräuchte nicht einmal zu fragen.
Linda fällt aus allen Wolken, als ich mich bei ihr melde. Schnell vereinbaren wir, daß ich sie am nächsten Wochenende besuchen komme, wenn ihre Kinder bei ihren Eltern zu Besuch sind und sie sturmfreie Bude hat. Anschließend an dieses Gespräch erklärt mir Bob, daß er sich von dieser Anwältin getrennt habe, da sie offenbar inkompetent gewesen sei. Er habe jetzt eine Adresse eines Einwanderungsanwalts in Birmingham, ein Orientale, der ihm sehr bewandert und engagiert erscheint. Wir beschließen, ihn anzurufen und für die kommende Woche einen Besuchstermin bei ihm auszumachen.
Am Samstag Morgen fliege ich dann nach Cincinnati, und Linda holt mich am Flughafen ab. Sie lädt mich zu einem Mittagessen bei LaRosa’s Pizzeria ein. Ich nehme die Gelegenheit wahr und frage sie, ob sie vielleicht daran interessiert sei, bei dem Verlag Theses & Dissertations Press, den ich nun zusammen mit Bob Countess aufbauen will, als Sekretärin angestellt zu werden. Sie ist geradezu enthusiastisch angesichts dieser Gelegenheit und sagt sofort zu. Nach dem Essen möchte mir Linda dann ihr Haus zeigen, daß sie gerade zum Verkauf angeboten hat. Wir steigen also wieder in ihr Auto und fahren ein paar Kilometer weiter. Während wir uns ihrem Haus nähern, reduziert sie das Tempo und wird zusehends nervös.
“Oh mein Gott, da sind je überall Polizisten.”
“Fünf Streifenwagen.” zähle ich geschwind.
“Du mußt wissen, daß ich Ärger mit meinem Sohn Paul habe. Er macht gerade eine Zwangstherapie wegen Schizophrenie mit und ist gestern aus dem Krankenhaus geflohen, wo er auf Anordnung der Polizei eigentlich hätte bleiben sollen”, erklärt Linda.
“Demnach sucht die Polizei nach ihm?” frage ich.
“Ich bin mir fast sicher. Sieh nur, das ist mein Haus. Sie haben mein Haus umstellt!”
Linda fährt ganz langsam am Haus vorbei. Plötzlich wird einer der Polizisten argwöhnisch ob des langsam vorbeifahrenden Autos und kommt daher auf unser Auto zu. In Sekunden sind wir von etwa zehn Polizisten umgeben, einige von ihnen zielen mit ihren Pistolen auf uns.
“Oh mein Gott, die zielen auf Dich!” schreit Linda auf.
“Hände hoch!”, schreit einer der Polizisten, aber irgendwie kann ich nicht glauben, daß die mich meinen. Das kann ja gar nicht sein. Warum sollten sie? Ich öffne also die Tür, um zu fragen, was eigentlich los ist, aber das war ein verhängnisvoller Fehler. Die Polizisten sind extrem nervös und hocherregt. Sie interpretieren dies offenbar als Bedrohung. Einer der Polizisten hält mir seine Pistole ins Gesicht. Ein anderer zerrt mich aus dem Auto und drückt mich bäuchlings auf den Rasen. Ein dritter legt mir Handschellen an. Ratsch-Ratsch. Das war’s…
Alle sind fürchterlich aufgeregt, vor allem Linda, die die Polizisten verzweifelt davon zu überzeugen versucht, daß ich nicht der bin, für den sie mich halten.
“Das ist nicht mein Sohn. Ihr habt den Falschen. Bitte laßt ihn gehen!” Sie ist völlig außer sich.
“Wer sind Sie denn?” wird sie gefragt. Sie reißen mich vom Rasen hoch. Linda weist sich mit ihrem Führerschein aus und erklärt, daß der, den sie wahrscheinlich suchen, ihr Sohn Paul Faith sei.
“Aber das ist nicht mein Sohn. Das ist nur ein Besucher, ein Freund, der mich hier in den Staaten besucht!”
“Ma’am, regen sie sich bloß nicht so auf! Bleiben sie dort bei ihrem Fahrzeug stehen und warten Sie, bis wir ihn identifiziert haben. Wenn Sie recht haben, dann gibt es gar keinen Grund, aufgeregt zu sein.”
Ich zittere am ganzen Leib. Inzwischen glotzt die ganze Nachbarschaft. Ich sage den Polizisten, daß sich mein Paß in der Innentasche meiner Jacke auf dem Rücksitz von Lindas Auto befindet. Ein Beamter holt die Jacke aus dem Auto, entnimmt ihr den Paß, und geht damit zu einem der Streifenwagen, offenbar, um meine Daten in eine Suchbank einzugeben. Ein anderer Beamter spricht per Funk mit irgend jemandem, um genauere Informationen über die Person zu erhalten, die gesucht wird. Ihm wird mitgeteilt, daß Paul Faith viele Tätowierungen am Arm hat. Flugs krempelt man mir meine Ärmel hoch und stellt fest, daß ich keine einzige Tätowierung habe.
“Das ist nicht unser Mann. Wir haben den Falschen. Das ist er nicht.” sagte einer der Polizisten.
Der Polizist, der meinen Paß kontrolliert hat, steigt annähernd zeitgleich aus seinem Wagen aus.
“Nichts. Der Junge ist sauber.”
Die Beamten nehmen mir die Handschellen ab, geben mir meinen Paß zurück und entschuldigen sich bei mir.
“Nun, wenn man all die üblichen Vorurteile über dieses Land hat, so ist das hier ja wohl so ziemlich genau das, was man erwartet, oder? Es war zumindest ein aufregendes Abenteuer”, antworte ich ihnen mit einem breiten Grinsen im Gesicht.
“Oh mein Gott! Da schaffst Du es mit Ach und Krach, aus dem belagerten Europa herauszukommen, und ich verpfusche hier beinahe alles. Es tut mir so leid!” entschuldigt sich Linda anschließend.
Willkommen in Amerika!
Die Jagd ist eröffnet
Mein Umzug auf Umwegen, Haken schlagend wie ein Hase, der einen Fuchs ablenken muß, dauerte einige Zeit. Kaum, daß ich mich aus dem Staub gemacht habe, tauchen dann Ende November tatsächlich zwei Herren in Hastings bei der Adresse auf, an der ich seit 1997 vorgebe zu wohnen. Sie suchen nach mir, sagen sie meinem Freund Howard, der ihnen aber nur berichten kann, daß er nicht weiß, wo ich bin (was glücklicherweise die Wahrheit ist), und daß er sich nur um meine Post kümmert. Daß die zwei Herren sich damit zufrieden geben, ist etwas seltsam. Aber womöglich wissen sie selbst, daß sie dort keine weiteren Informationen erwarten können. Schließlich habe ich ja nach britischem Recht kein Verbrechen begangen, und so können sie rein gar nichts dagegen unternehmen, daß ich aus dem Untergrund heraus meine völlig legalen Geschäfte mit Hilfe meiner Freunde weiterführe.
Die Dinge gestalten sich anfangs freilich schwierig. Unser neues Postzustellsystem ist aus Sicherheitsgründen recht kompliziert, und es dauert Wochen, bis ich meine Post bekomme. Es kommt somit zu einigen Pannen, über die sich einige meiner Kunden endlos aufregen. Ach, wenn die nur wüßten, unter welchen Bedingungen ich arbeiten muß!
In all dem Tumult versucht mich David Irving zu erreichen. Er will, daß ich die gegen ihn eingereichten Gutachten von Deborah Lipstadts Experten meinerseits begutachte. Aus Sicherheitsgründen habe ich auch all meine englischen Internetkonten kündigen müssen, und es hat einige Zeit gedauert, bis ich einen Weg gefunden habe, wie man einen finanzierbaren Internetzugang erhalten kann, den die Behörden in England nicht so einfach zu meiner Telefondose zurückverfolgen können. So kommt es, daß ich Irving meine Kommentare erst kurz vor dem Kreuzverhör des wichtigsten Zeugen, Prof. van Pelt, zukommen lassen kann. Irvings Prozeß hat darunter wahrscheinlich sehr gelitten. Viele Freunde stellen daher die Vermutung an, daß man gegen mich absichtlich eine Hexenjagd losgetreten hat, um es David Irving unmöglich zu machen, sich vernünftig zu verteidigen. Vielleicht ist da etwas Wahres dran, denn noch am 7. Januar äußert Kim Murphy in einem recht fairen Artikel in der Los Angeles Times die Ansicht, ich könnte durchaus für Irving als Experte auftreten. Der Gedanke allein kann bei bestimmten Gruppen vielleicht tatsächlich Panik ausgelöst haben. Aber wer weiß schon, daß Irving dies nie wirklich beabsichtigt hat…
Am 16. Januar dann, pünktlich zu Irvings Prozeßbeginn, posaunt Chris Hastings seinen Triumph im Telegraph heraus, frei nach dem Motto: ‘Hurra, ich habe das Nazi-Schwein erledigt! Ich bin ein glorreicher Drachentöter, ein heldenhafter Großinquisitor, ich habe einen unschuldigen, machtlosen jungen Mann zur Strecke gebracht!’ Noch nicht ganz, Herr Hastings, denn ein erlassener Haftbefehl, über den er sich so freut, ist nicht gleichzusetzen mit dessen Umsetzung! Aber die Sprache wird nun sehr deutlich:
“Die Polizei hier hat sich der Jagd auf Germar Rudolf angeschlossen”
Menschenjagd auf Dissidenten im “freien Westen”.
Ein Bericht der BBC vom 28.3.2000 läutet dann die Menschenjagd auf mich ein. Er wird am Tag darauf im südenglischen Regionalfernsehen ITV wiederholt und zeigt einige aus dem Internet stammende Bilder von mir.[7]
Zugleich wurden die Zuschauer eindringlich vor diesem “Nazi-Sympathisanten” gewarnt, so als wäre ich ein gefährlicher Schwerverbrecher. Mike Whine vom englischen Zentralrat der Juden spricht von einer neuen Brut gefährlicher Nazis.
Um das ganze Ausmaß dieser Hexenjagd erfassen zu können, muß man wissen, was der englische Fernsehzuschauer unter einer “gefährlichen Brut neuer Neo-Nazis” wahrscheinlich versteht: Im Jahr 1999 wurden in London zwei schwere Bombenattentate gegen Farbige und Homosexuelle verübt, denen viele Menschen zum Opfer fielen. Die Presse machte dafür – wie immer vorschnell – “gefährliche Neo-Nazis” verantwortlich. Noch nicht einmal ein Jahr später berichtet die BBC über mich als eine “neue Brut gefährlicher Neo-Nazis”. Der Sender zeigt viele Bilder von mir, stellt mich als Kriminellen vor, der sich immer noch in der Gegend von Hastings verstecke, und die Bevölkerung solle wachsam sein. Was muß der Normalbürger also denken, was für ein Mensch ich bin? Ein massenmordender, bis an die Zähne bewaffneter gemeingefährlicher Schwerstverbrecher?
Die Lokalpresse in Hastings, der Hastings & St. Leonards Observer, konnte sich kurz darauf, am 31. März, natürlich auch nicht mehr zurückhalten:
“Entkommener Neo-Nazi versteckt sich immer noch in Hastings […] er wird immer noch gejagt.”
Offenbar will man erreichen, daß die lokale Bevölkerung mich erkennt und aus Angst vor diesem “Unmenschen” umgehend die Polizei verständigt.
Doch wen juckt es wirklich? Nun, das britische Unterhaus sah sich am 22. Mai veranlaßt, meinen Fall zu erwähnen. Das umtriebige Labour-Parlamentsmitglied Andrew Dismore hatte den Innenminister während einer Sitzung zur Verbrechensvorbeugung [sic!] aufgefordert, zu meinem Fall Stellung zu nehmen. Die Antwort des Innenministeriums war zwar nicht umfangreich:[8]
“Die Regierung weiß um die Berichte von bestimmter Seite, daß Herr Rudolf im Vereinigten Königreich sein mag. Die Polizei ist über die Angaben zu Herrn Rudolf unterrichtet worden.”
Sie enthüllt aber doch, daß man sich für den Fall ganz oben interessiert und davon ausgeht, daß die Polizei den Fall lösen wird – mit Handschellen, womit auch sonst…
Das Stephen Roth Institut der Universität Tel Aviv fertigt jedes Jahr einen Bericht über den Antisemitismus in der Welt an. Aufgrund typisch jüdischem Verfolgungswahn wird dort der Revisionismus ebenfalls aufgeführt. In der Rubrik für Deutschland geht es unter “Revisionismus” im neuesten Bericht von 1999/2000 nur um eine Person: Germar Rudolf.[9]
Hatte die Stiftung Vrij Historisch Onderzoek in den Jahren bis 1999 wenigstens noch die Ehre, als zweites genannt zu werden, so konzentriert sich seit neuestem alles nur noch auf mich.[10]Der Bundesverfassungsschutzbericht des Jahres 2003 meint dann auch lakonisch, ich sei inzwischen weltweit der einzige Revisionist, der noch im erwähnenswerten Ausmaße produktiv sei:[11]
“Lediglich […] Germar Rudolf setzte seine Aktivitäten im bisherigen Maße fort.”
Viel Feind, viel Ehr.
Szenenwechsel
Ende Juli 2000. Alle Versuche, ein Arbeitsvisum für die USA zu bekommen, sind gescheitert. Ich habe die USA verlassen, um Ärger mit den Einwanderungsbehörden zu vermeiden, und habe mich zeitweilig in Rosarito niedergelassen im Staate Baja California, Mexiko. Dort habe ich ein kleines Häuschen direkt neben dem Heim von Bradley Smith gemietet, dem Chef von CODOH (Committee for Open Debate on the Holocaust). Von hier aus plane ich meinen nächsten Schritt: die Beantragung von politischem Asyl in den USA. Es wird ein verzweifelter letzter Versuche sein, ins Land zu kommen.
Während meines zehnwöchigen Aufenthalts in Mexiko werden Bradley und ich enge Freunde. Ohne ihn hätte ich mich in Mexiko völlig verloren gefühlt. Im August buche ich einen Flug nach Island über New York. Obwohl Island nur ein assoziiertes Mitglied der EU ist, macht es mich nervös, als ich dort beim Verlassen des Flughafens in Reykjavik meinen Paß vorzeigen muß, aber nichts passiert.
Ein kalter Wind weht durch Islands Hauptstadt und treibt die Wolken übers Land. Die Sonne müht sich ab, die Temperaturen in einem annehmbaren Bereich zu halten, obwohl es August ist, nur wenige Tage nach dem 59. Geburtstag meiner Mutter. Zusammen mit meiner Ex-Frau und meinen beiden kleinen Kindern ist sie hierher gekommen, um mich zu sehen. Wir treffen uns in der Mitte zwischen Europa und Mexiko, wo die Kontinente auseinandertreiben und wo sich das Innerste der Erde nach außen kehrt. Zu jenem Zeitpunkt habe ich bereits eine vieljährige Tortur von Verfolgungen über mich ergehen lassen müssen, verursacht durch jene Mächte, die mich mit meinem Wissen und Fähigkeiten nicht ungestraft davonkommen lassen wollen. Und so wie ich gestrickt bin, habe ich nicht nachgegeben. Der Widerstand gegen mein Tun und der auf mich ausgeübte Druck haben mich nur noch hartnäckiger werden lassen. Der junge Student von damals ist zu einem Wissenschaftler der ärgerlichsten Sorte geworden: Ich forsche dort, wo viele Mächtige nicht zulassen wollen, daß geforscht wird, und ich publiziere meine eigenen Ergebnisse und die Dritter, welche die Behörden zensiert sehen wollen. Vor geraumer Zeit habe ich mich dazu entschlossen, meine vielversprechenden Karriereaussichten als ein Professor für Kristallographie aufzugeben und statt dessen dem nachzugehen, was ich als das größte aller Abenteuer empfinde: sich mutig auf intellektuelles Gebiet zu begeben, wohin sich bisher niemand vorgewagt hat, allein schon deshalb, weil man mir verbieten will, mich dorthin vorzuwagen. Ausgegrenzt, verleumdet, verfolgt, verurteilt, den akademischen Titel vorenthalten, aus Haus und Heim geworfen, die Anstellung gekündigt, aus Vereinen ausgeschlossen, von “Freunden” und sogar Teilen der Familie gemieden, und letztlich von der eigenen Frau verlassen, lebe ich nun im Ausland, auf einem anderen Kontinent, und alle Brücken hinter mir sind abgebrannt. Zurückblickend auf die Verwüstungen, die meine Aktivitäten in meinem eigenen Leben verursacht haben, aber auch auf das Chaos, das ich auf nationaler wie internationaler Ebene als Ein-Mann-Vorstellung ausgelöst habe, stimmt meine Mutter endlich mit mir überein:
“Gut, Du hast recht, es ist von enormer Bedeutung, aber als Mutter kann ich einfach nicht akzeptieren, daß sich eines meiner Kinder dermaßen in Gefahr begibt.”
Dieses späte Eingeständnis meiner Mutter, bisher unehrlich gewesen zu sein oder aber die Lage falsch eingeschätzt zu haben, verblüfft mich:
“Jetzt, acht Jahre später, habe ich das erste Mal eine aufrichtige Aussage aus Deinem Mund gehört, die ich akzeptieren kann. War das so schwierig? Ich verstehe, daß es die Pflicht einer Mutter ist, ihre Kinder vor Gefahren zu bewahren, aber Mama, ich bin jetzt gut über dreißig. Meinst Du nicht, daß ich für mich selbst verantwortlich bin? Du weißt sehr gut, wie ich reagiere, wenn mich jemand gegen meinen Willen zu etwas zwingen will. Du kennst mich gut genug. Ob es nun mein Vater ist, der meinen Willen brechen will, oder ob es die deutschen Behörden sind, die mich mit Gefängnis bedrohen, weil ich das Unanzweifelbare bezweifle, es läuft auf des Gleiche hinaus. Warum hast Du Dich also mit Deinen dummen, dogmatischen, paradoxen Äußerungen gegen mich gestellt? Das hat mich nur noch tiefer hineingetrieben!”
Wir schlendern Reykjaviks Strandpromenade entlang, und sie fährt fort:
“Ich werfe mir vor, Dich mit zu strikten moralischen Werten großgezogen zu haben. Mußt Du immer aufrichtig sein, und mußt Du immer die ganze Wahrheit sagen? Kannst Du nicht ab und zu ein wenig lügen, oder zumindest nur eine Teilwahrheit sagen, wenn Dir klar ist, daß Deine Umwelt die ganze Wahrheit nicht hören will? Als Junge hast Du immer nach Gründen gesucht, um zu verstehen, warum Dein Vater Dich so harsch und oft ungerecht behandelt hat. Ich habe Dir damals erzählt, wie er und seine Familie nach dem Krieg ungerecht behandelt wurden, und ich glaube, daß Du dem Deine Aufmerksamkeit gewidmet hast. Seither hast Du Ausschau gehalten für Ungerechtigkeiten, die Deiner Familie, Deinem Stamm, Deinem Vaterland angetan wurden. Du bist ein Gerechtigkeitsfanatiker, und Du gibst erst auf, wenn der Gerechtigkeit genüge getan wurde. Ich denke, daß ich Dich auf die falsche Fährte gesetzt habe, als ich die ungerechte Behandlung durch Deinen Vater darauf abschob, daß er und seine Familie aus Ostdeutschland vertrieben wurden.”
Ich meine, hier eingreifen zu müssen; obwohl da etwas dran sein mag, ist es nicht allein ihre Schuld.
“Bis zu meinem 19. Lebensjahr hatte ich keinerlei Interesse an Geschichte, und erst recht nicht an Geschichtsforschung. In der Schule war mir das Fach tatsächlich zuwider. Deswegen bist Du diesbezüglich im wesentlich aus der Verantwortung. Dieser Anstoß kam von woanders. Er kam von der ostdeutschen Studentenverbindung, in der ich damals ein Mitglied war, von meiner Inhaftierung in einem tschechischen Gefängnis, von Einsichten in die Machtspiele innerhalb der deutschen Gesellschaft unter Verwendung einer gefälschten deutschen Geschichte als Waffe. Und ich meine zudem, daß mein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn sowie meine Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit, zusammen mit meiner Willenskraft, Eigenschaften sind, die mir innewohnen. Ich denke nicht, daß die Dinge sich anders entwickelt hätten, wenn ich Deine katholischen Moralvorstellungen nicht für die längste Zeit meines Lebens um mich herum gehabt hätte.”
Wenige Tage später trennen sich unsere Wege, unwissend, daß ich meine Mutter und meinen Sohn erst im Jahre 2004 das nächste Mal sehen werde, und meine Tochter erst ein Jahr später, wenn sie fast 11 Jahre alt sein wird.
Zwei Monate später, im Oktober 2000, beantrage ich politisches Asyl in den USA. Und das wird das letzte Mal sein, daß ich irgendwelchen Behörden über den Weg traue.
INS # A 78 66 00 16, schwebendes Verfahren.[12]
Diese Geschichte ist Thema des nächsten Kapitels.
Anmerkungen
Entnommen dem Buch von Germar Rudolf, Kardinalfragen an Deutschlands Politiker: Autobiographische Skizzen und Gedankensplitter zu Wissenschaft, Politik und Menschenrechten, Artikel mit dem Titel „Jagd auf Germar Rudolf“ zweite, revidierte und erweiterte Auflage, Juli 2012, Uckfield (East Sussex): Castle Hill Publishers
| Diese Geschichte ist Thema des nächsten Kapitels. | |
| [1] | Vergleichbar der NPD in Deutschland. |
| [2] | Eine noch weiter rechts angesiedelte Gruppierung, über die ich herzlich gar nichts weiß. |
| [3] | Bis ich im Sommer 2009 die Gelegenheit bekam, zum gleichen Ort zurückzukehren und ein ganzes Jahr lang fast täglich wenn schon nicht die gleiche, so doch eine sehr ähnliche Radtour zu machen. |
| [4] | Dieser Artikel und weitere Dokumente bezüglich meiner Verfolgung sind auf meiner Webseite ausgehängt: germarrudolf.com?page_id=671. |
| [5] | Ich gebe hier die Wortwahl von Corinne original wieder und distanziere mich zugleich davon. Niemand hat eine solche Wortwahl verdient. Sie offenbart nur Corinnes eigene Ungezogenheit. Ich entschuldige mich zugleich bei Wolfgang, daß ich damals mit Corinne keinen Streit anfing, um seinen Ruf zu schützen. Ich hatte damals nur im Sinne, mit heiler Haut davon zu kommen. |
| [6] | Es stellte sich später heraus, daß ich tatsächlich zurückkehren würde – 9 Jahre später, um ein Jahr lang in Eastbourne gleichen neben den wunderbaren Downs zu wohnen. Aber jenen besonderen Ort in den Downs habe ich nie wieder besucht. Ich fürchtete mich vor den Gefühlen, die er hervorrufen würde. |
| [7] | www.vho.org/Authors/Germar_Rudolf.html. |
| [8] | www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/cm199900/cmhansrd/cm000522/text/ 00522w13.htm#00522w13.html_sbhd1 |
| [9] | www.tau.ac.il/Anti-Semitism/asw99-2000/germany.htm |
| [10] | Vgl. den Bericht von Günther Hörbst, Hamburger Abendblatt, 27.5.2000. |
| [11] | Bundesminister des Innern, Verfassungsschutzbericht 2003, Pressefassung, Berlin 2004, S. 100. |
| [12] | Der Fall wurde Anfang 2006 abgeschlossen: Asyl abgelehnt; Dissident nach Deutschland abgeschoben und prompt inhaftiert; danach aufgrund eines neuen Strafverfahrens weiter in Haft gehalten; zu weiterer Gefängnisstrafe verurteilt; schließlich am 5. Juli 2009 entlassen; aber ich greife den Ereignissen voraus …
|